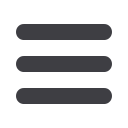

31
Das deutsch-italienische Anwerbeabkommen vom 20. Dezember 1955
Einsichten und Perspektiven 4 | 15
rung beabsichtigte zu dieser Zeit den Abschluss eines sol-
chen Abkommens mit Italien. Weil Frankreich sowohl
Dollar als auch italienische Lire fehlten, um die Erspar-
nisse italienischer Arbeitsmigranten nach Italien transfe-
rieren zu können, schienen nämlich Kohlelieferungen der
einzige Ausweg.
16
Italienische Arbeitsuchende waren gleich 1945 spon-
tan, das heißt, bis zum ersten Abkommen vom Februar
1946 ohne völkerrechtliche Regelung nach Frankreich
gewandert. Im Zeichen von Dollar-Lücke und nicht kon-
vertierbaren europäischen Währungen mussten ihre Hei-
matüberweisungen spätestens zu dem Zeitpunkt zu einer
Belastung für die französische Devisen- und damit Zah-
lungsbilanz werden, als auch Frankreichs Handelsbilanz
ein Defizit gegenüber Italien aufwies. Frankreich befand
sich schnell in diesem Dilemma (vgl. Tabelle 2), das ohne-
hin stark auf US-amerikanische Kredite angewiesen blieb.
Tabelle 2: Französischer Außenbeitrag gegenüber
Italien und Heimatüberweisungen der Migranten
nach Italien, 1948–1950 (in Mio. Lire)
Außenbeitrag
(Exporte - Importe)
Heimatüberweisungen
1948
-10.352
-6.325
1949
-10.460
-7.921
1950
-18.016
-5.425
Quelle: Centre des Archives économiques et financières (CAEF), B-0010781/2.
Ambassade de France en Italie, l’Attaché financier, 15 juillet 1951. Les paie-
ments franco-italiens en 1950, 15.07.1951.
Die sich problematisch gestaltende Devisenlage Frank-
reichs veranlasste Italien schließlich, pauschal 14 Mrd. Lire
als Entschädigungssumme für Kriegsschäden sowie hieraus
folgende weitere 2,6 Mrd. Lire aus Wertsicherungsansprü-
chen mit der Auflage bereitzustellen, diese für die Heimat-
überweisungen der Arbeitsmigranten zu nutzen.
17
Streng
genommen entlohnte Italien also seine in Frankreich arbei-
tenden Landsleute selbst und sorgte damit auch dafür, dass
16 Vgl. Heike Knortz: Gastarbeiter für Europa. Die Wirtschaftsgeschichte
der frühen europäischen Migration und Integration, Köln/Weimar/Wien
2016, S. 88ff.
17 Vgl. Knortz (wie Anm. 16), S. 104ff.; sowie insgesamt auch: Pierre Guillen:
L’immigration italienne en France après 1945, enjeu dans les relations fran-
co-italiennes, in: Michel Dumoulin, (Hg.): Mouvements et politiques migra-
toires en Europe depuis 1945: Le cas italien. Actes du colloque de Louvain-
la-Neuve des 24 et 25 mai 1989, S. 37–51, Louvain-la-Neuve 1989.
es weiter Waren nach Frankreich exportieren konnte. Auf
bilateraler Ebene hatte Italien mit dieser Transferleistung
das EZU-System gegenseitiger Hilfe bereits vorweggenom-
men. Finales Ziel war dabei „die Stärkung der wirtschaftli-
chen Beziehungen der beiden Länder im Rahmen der allge-
meinen europäischen Zusammenarbeit.“
18
Das weiter stark
wachsende französische Außenhandelsdefizit gegenüber
Italien mündete schließlich dennoch in einer restriktiveren
französischen Außenwirtschaftspolitik zu Lasten Italiens.
19
In einem weiteren Schritt setzte Frankreich, wo zudem
noch die Arbeitslosigkeit seit einigen Jahren stark angestie-
gen war, Ende 1954 die Heimatüberweisungen nach Italien
aus.
20
Weil sich die italienische Migration nach Übersee
ebenfalls in nur begrenztem Rahmen bewegte und auch
italienische diplomatische Initiativen für eine allgemeine
Freizügigkeit
21
von Personen in Europa noch nicht zu der
angestrebten Massenmigration führten, musste die italie-
nische Administration spätestens jetzt im Rahmen ihrer
Europapolitik nach Alternativen suchen, um überschüs-
sige Arbeitskräfte auswandern zu lassen und mit deren
Heimatüberweisungen die eigene Zahlungsbilanz entlas-
ten zu können.
Vorgeschichte und Zustandekommen des deutsch-
italienischen „Anwerbeabkommens“
Im Rahmen der Europäischen Zahlungsunion war zu die-
sem Zeitpunkt ohnehin auch die Bundesrepublik gefor-
dert. Im Zuge des Korea-Kriegs (1950–1953) begann die
bundesdeutsche Wirtschaft nämlich zu boomen, schlug
der ehedem auch hier bedrohliche Devisenmangel in
sein Gegenteil, in Devisenzuflüsse um. Jetzt standen also
westdeutschen Handelsbilanzüberschüssen umfangreiche
Defizite in anderen europäischen Ländern, besonders in
Italien, gegenüber. Die durch die Zahlungsunion zwin-
gend notwendigen Anpassungsmaßnahmen ließen diese
Ungleichgewichte der Zahlungsbilanz seit 1952
22
zu einem
18 Vgl. CAEF, B-0010783/2. Ministère des Finances, Direction du Budget N°
4870. Direction des Finances Extérieures, 2 mai 1949. Note pour le Ministre.
19 Vgl. Archives diplomatiques, 193QO/260. [Télégramme à l’arrivée] S.M.
Déchiffrement. Rome, le 10 mai 1952 à 7 heures, N° 359/65, S. 137–140,
hier S. 137.
20 Vgl. Guillen (wie Anm. 17), S. 47.
21 Zu diesen italienischen Vorstößen siehe das gesamte Kapitel „Die inter-
nationale Gemeinschaft und der italienische Arbeitskräfteüberschuss“ bei
Knortz (wie Anm. 16), S. 120–160.
22 Vgl. Francesco Masera: Italy’s Balance of Payments in the Post-War Peri-
od, in: Banco di Roma (Hg.): Review of the Economic Conditions in Italy.
Ten Years of Italian Economy 1947–1956, Roma 1957, S. 165–202, hier
S. 177 und 196.


















