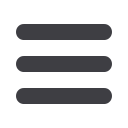

33
Das deutsch-italienische Anwerbeabkommen vom 20. Dezember 1955
Einsichten und Perspektiven 4 | 15
das Auswärtige Amt dabei aus dem Bundeswirtschaftsmi-
nisterium, das die italienischen Beschäftigungsprobleme
als eng mit wirtschaftspolitischen, vor allem aber mit Fra-
gen des Zahlungsverkehrs verknüpft sah.
26
Auch deshalb
hatte Wirtschaftsminister Ludwig Erhard schon 1954 in
Mailand und Genf eigenmächtig „die Hereinnahme von
200.000 italienischen Landarbeitern in Aussicht gestellt,
als von der Notwendigkeit die Rede war, einen Fehlbetrag
im deutsch-italienischen [EZU-]Clearing durch Arbeits-
einkommen italienischer Arbeitskräfte zu decken.“
27
Das Bundesarbeitsministerium verhielt sich gegenüber
der geplanten Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte
zumindest zu dem Zeitpunkt noch ablehnend, zu dem
in der Bundesrepublik allgemein noch Arbeitslosigkeit
herrschte und laufend Flüchtlinge aus der DDR zuwan-
derten. Dem Bundesminister für Arbeit, Anton Storch,
hatte Ludwig Erhard deshalb seinen Standpunkt bereits
Anfang Oktober 1954 im Zusammenhang mit der Dis-
kussion um die Beschäftigung von Saisonarbeitskräften
in der westdeutschen Landwirtschaft unmissverständlich
dargelegt: „Die anhaltende defizitäre Entwicklung der ita-
lienischen Zahlungsposition innerhalb der Europäischen
Zahlungsunion, die weitgehend aus dem deutsch-italieni-
schen Verhältnis herrührt, stellt eine starke Gefährdung
der gemeinsamen Bestrebungen nach einer immer enge-
ren europäischen wirtschaftlichen Zusammenarbeit dar.
[…] Echte Möglichkeiten für einen ausschlaggebenden
Beitrag zur Bereinigung der italienischen Zahlungssitua-
tion sehe ich lediglich noch in der Beschäftigung italieni-
scher Saisonarbeiter.“
28
Zu den von Erhard auch in der Folge bemühten europä-
ischen Pflichten gehörte neben einer weiteren bundesdeut-
schen Handelsliberalisierung auch die Beteiligung Italiens
an den bevorstehenden deutschen Rüstungsaufträgen,
29
so dass Italien über verstärkte Exporte in den Besitz von
D-Mark gelangen konnte. Der bevorstehende Aufbau der
Bundeswehr drohte dem zwischenzeitlich sich entspan-
26 Vgl. BA Koblenz, B 149/6228. Vermerk Abteilung I, Geschäftszeichen Ia
8 – 2359/54II vom 19. Januar 1955.
27 PA Berlin, B 62/54. Ref.: LRI Dr. Lenz, Dr. Oppenheim. Vermerk betr. Be-
schäftigung von ca. 400.000 italienischen Arbeitnehmern in der BRD vom
20. November 1954.
28 PA Berlin, B 62/54. V C 4 a – 38 072/54, vom 8. Oktober 1954. Abschrift
eines Schreibens Ludwig Erhards an den Bundesminister für Arbeit, Herrn
Anton Storch.
29 Vgl. PA Berlin, B 62/54. V C 2 b – 816/54. Geheime Aufzeichnung über
die Besprechungen mit dem italienischen Haushaltsminister Professor Dr.
Ezio Vanoni am 13. und 14. Dezember 1954 im Bundesministerium für
Wirtschaft, 15. Dezember 1954.
nenden westdeutschen Arbeitsmarkt zudem Arbeitskräfte
zu entziehen. Durch den hier wie übrigens zuvor bereits
in Frankreich überschätzten Arbeitskräftebedarf
30
ist das
deutsch-italienische Anwerbeabkommen 1955 unter erhöh-
tem außenwirtschaftlichen Druck unterzeichnet worden.
Initiative und laufendes Insistieren gingen dabei unzwei-
felhaft von italienischer Seite aus, die anhaltend mit hoher
Arbeitslosigkeit kämpfte und schwere innenpolitische Fol-
gen bis hin zu kommunistischen Umtrieben befürchtete.
31
Die offiziellen bundesdeutschen Verlautbarungen nach
der Unterzeichnung der deutsch-italienischen Vereinbarung
über die Anwerbung italienischer Arbeitskräfte hoben pri-
mär die arbeitsmarktpolitischenVorteile hervor. Demzufolge
wurde damit gerechnet, dass künftig Arbeitsplätze nicht
mehr besetzt werden und sich damit westdeutsche Konjunk-
tur und Produktion rückläufig entwickeln könnten.
32
Trotz
stiller Arbeitsmarktreserven, industrieller Rationalisierungs-
maßnahmen sowie des anhaltenden Flüchtlingsstroms aus
der DDR befürchtete die Bundesregierung für 1957 infolge
der Wiederbewaffnung Spannungen am Arbeitsmarkt.
33
Derweil ist allerdings auch auf den beabsichtigten Abbau des
Handelsbilanzungleichgewichts zwischen den beiden Län-
dern und den damit verbundenen Vorteil für die Bundes-
republik verwiesen worden, weshalb man sich Italien durch
das Abkommen auch weiterhin als verlässlichen Abnehmer
deutscher Waren zu sichern glaubte.
Bundesdeutsche Arbeitsmarktinteressen vs. europäische
Verpflichtungen
Werden die italienischen Handels- und Zahlungsbilanz-
probleme außer Acht gelassen, sprachen die realwirtschaft-
lichen Entwicklungen in der Bundesrepublik zunächst
noch gegen die Erfüllung europapolitischer, den westdeut-
schen Arbeitsmarkt zusätzlich belastender Verpflichtun-
gen. So sind beispielsweise von rund 10.000 zusätzlichen
Arbeitskräften, die im Januar 1955 zunächst als unbedingt
notwendig bezeichnet wurden und deshalb anzuwerben
30 Vgl. Steinert (wie Anm. 2), S. 207; Die überschüssigen Arbeitskräfte in
Westeuropa, in: Europa-Archiv 4 (1949), S. 1911–1916.
31 Vgl. hierzu ausführlich: Knortz (wie Anm. 3), S. 67–83.
32 Vgl. BA Koblenz, B 149/6230. Zur Anwerbung italienischer Arbeitskräfte.
Das deutsch-italienische Abkommen – Die Verhältnisse auf dem Arbeits-
markt, in: Bulletin, Nr. 4 vom 6. Januar 1956, S. 27 f.
33 Vgl. BA Koblenz, B 149/6230. Referent BVOR Dr. Zöllner i.V., Abteilung
II, Geschäftszeichen – IIb4 – 2471 – vom 28. Dezember 1955 an die U.-
Abteilung IIa, betr. Deutsch-italienische Vereinbarung über die Anwer-
bung italienischer Arbeitskräfte; hier: Unterrichtung der OEEC: Entwurf
eines kurzen Vortrags über die Bedeutung und den wesentlichen Inhalt
der obigen Vereinbarung.


















