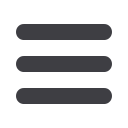

34
Das deutsch-italienische Anwerbeabkommen vom 20. Dezember 1955
Einsichten und Perspektiven 4 | 15
seien, schließlich nur 208 italienische Landarbeiter tatsäch-
lich angefordert und beschäftigt worden.
34
Gemeinsame
Überprüfungen der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung
und Arbeitslosenversicherung und der Bauernverbände
ergaben allgemein, dass zumindest die veröffentlichten
Bedarfszahlen regelmäßig stark überhöht waren und der
Arbeitskräftebedarf im Wesentlichen noch auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt gedeckt werden konnte.
35
Das war
auch der Grund, warum westdeutsche Arbeitgeberver-
bände und Gewerkschaften die Anwerbung ausländischer
Arbeitskräfte zu dieser Zeit noch generell und einträchtig –
mit Ausnahme der bereits jetzt Engpässe an Arbeitskräften
beklagenden land- und forstwirtschaftlichen Arbeitgeber-
verbände – ablehnten.
36
Die Konflikte um bundesdeutsche Arbeitsmarktinter-
essen, denen das Bundesarbeitsministerium qua Funktion
nachzukommen hatte, und europäischen Verpflichtun-
gen, auf deren Einhaltung das Auswärtige Amt zu achten
und das Bundeswirtschaftsministerium aus wachstumspo-
litischen Gründen zu bestehen pflegte, verhinderten im
Übrigen von Beginn an eine den Einsatz ausländischer
Arbeitskräfte berücksichtigende arbeitsmarktpolitische
Konzeption. Die Beschäftigung ausländischer Arbeits-
kräfte sollte dadurch bis zum Anwerbestopp 1973 gerade
nicht von westdeutscher Arbeitsmarktpolitik und auch
bald nicht mehr von europapolitischen Notwendigkeiten
bestimmt werden, fortan vielmehr ohne wirtschaftliches
Konzept den vielfältigsten außenpolitischen Bedürfnissen
Westdeutschlands folgen, die sich mit außenwirtschaftli-
chen allerdings durchaus decken konnten. Unter diesem
Vorzeichen standen die folgenden Anwerbevereinbarun-
gen mit dem nicht der EWG angehörenden Spanien,
Griechenland, Portugal, Jugoslawien sowie der Türkei in
den 1960er Jahren, wobei das Attribut „Anwerbung“ wie
im Fall des deutsch-italienischen Abkommens irreführend
ist, da die Initiative zu diesen, aber auch ähnlichen Verein-
barungen mit Marokko und Tunesien, ausschließlich vom
Ausland ausging.
37
34 Vgl. BA Koblenz, B 119/3023. Vermerk des Referenten BVR Dr. Reber i.V.,
Unterabteilung Ia, Ia4 – 5750/5100 – vom 28. September 1955. Betr. Aus-
länder in Deutschland, Allgemeine Fragen der Arbeitsmarktbeobachtung.
35 Vgl. PA Berlin, B 85 (2. Abgabe)/548. Botschaft der Bundesrepublik
Deutschland Rom, 553-11/Nr. 2194/55, vom 20. Mai 1955. Anforde-
rung italienischer Arbeitskräfte. Bezug: Bericht vom 27.4.55; sowie: Der
Bundesminister für Arbeit, Tagebuch-Nr. II b 4 – 2471 – 529/55 an das
Auswärtige Amt – Abteilung V – vom 10. Juni 1955. Betr. Hereinnahme
italienischer Arbeitskräfte.
36 Vgl. Knortz (wie Anm. 3), S. 73ff.
37 Vgl. hierzu Knortz (wie Anm. 3) passim.
Italienische Arbeitskräfte bei der Ankunft in München, 1959
Foto: SZ Photo/Fotograf: Jenö Kovacs
Arbeitsmigration und Kindergeldzahlungen als Akt
europäischer Solidarität
Die am 20. Dezember 1955 in Rom gegen unterschied-
liche innenpolitische Widerstände unterzeichnete Regie-
rungsvereinbarung „über die Anwerbung und Vermittlung
von italienischen Arbeitskräften nach der Bundesrepublik
Deutschland“ war entgegen offizieller Verlautbarungen
in erster Linie europäischer Solidarität geschuldet. Zur
europäischen Komponente dieser Vereinbarung zählte die
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) zunächst einen
weiteren Devisentransfer: „Das Neue in dem Abkommen
liegt aber vor allem in der Bestimmung über das Kinder-
geld. Es wird auch bei den Saisonarbeitern gezahlt. Für
die kinderreichen italienischen Familien ist es von großer
Bedeutung. Man kann es verstehen, daß von italienischer


















