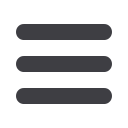

39
Einsichten und Perspektiven 4 | 15
Das Bild der Stadt
Die moderne Stadt wuchert in die Landschaft hinaus;
Stadtkonglomerate gehen ineinander über, so dass man
ohne ein Ortsschild die Grenzen zwischen den einzelnen
Kommunen gar nicht wahrnehmen würde. Auch im länd-
lichen Raum findet man diese Entgrenzung der Bebauung.
Die mittelalterliche Stadt hingegen hatte durch die sie
umfassende Mauer eine feste Form, ein Weichbild, eine
charakteristische Silhouette. Dieses völlig andere Bild einer
Stadt des 14./15. Jahrhunderts hat Gustav Freytag in seiner
Kulturgeschichte beschrieben:
1
Große und kleine Türme
„stehen, aus der Ferne betrachtet, dicht gedrängt, nicht nur
an Kirchen und Rathaus, auch zwischen den Häusern, als
Überrest alter Befestigung“. Groß ist die Zahl der Tor- und
Mauertürme; bei bevölkerungsreichen Städten sind es Dut-
zende. „Diese Türme, quadratisch oder rund gebaut, von
ungleicher Höhe und Dicke, sind bei einer reichen Stadt
mit Schiefer oder Ziegeln gedeckt, vielleicht mit metallenen
Knäufen versehen, welche im Sonnenlicht wie Silber glän-
zen, kleine Fahnen darauf und hie und da ein vergoldetes
Kreuz.“ Denn die Mauer soll nicht nur Schutz bieten, son-
dern Wohlstand und städtische Freiheit, ja sogar die Fröm-
migkeit der Bewohner repräsentieren.
Die Moderne begann im 19. Jahrhundert, als man die
Städte „entfestigte“, die mittelalterlichen Mauern und den
Klammergriff der barocken Bastionen beseitigte. Eine Befrei-
ung? Zeitgenossen mag es so erschienen sein. So lässt Goethe
im „Osterspaziergang“ den Dr. Faustus die Menschen beob-
achten, die „aus dem hohlen finstern Tor“ ihrer ummauerten
Stadt heraus in die Frühlingssonne streben. Sie kommen „aus
niedriger Häuser dumpfen Gemächern, / aus Handwerks-
und Gewerbebanden, / aus dem Druck von Giebeln und
Dächern, / aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht…“
2
Auch dies
ist ein Bild der mittelalterlichen Stadt. Eine Mauer bedeutete
Enge in mehrfacher Hinsicht: Raumknappheit, Beschrän-
kung wirtschaftlichen Handelns und die Finsternis der Reli-
gion gegenüber dem Licht der Aufklärung. Indes wurde
schon im frühen 19. Jahrhundert der ästhetische und histo-
rische Wert des mittelalterlichen Stadtbildes erkannt. Eines
der frühestenMaßnahmen des Denkmalschutzes stammt von
dem bayerischen König Ludwig I. Sein Erlass von 1826
3
hat
1 Gustav Freytag: Bilder aus deutscher Vergangenheit (1874). Neuausgabe,
3 Bde., hier Bd. 1, Gütersloh o.J., S. 230ff.
2 Johann Wolfgang von Goethe: Faust. Der Tragödie erster Teil. Werke, Ber-
liner Ausgabe Bd. 8, Berlin und Weimar 1978, S. 178.
3 Vgl. Hermann Kessler: Die Stadtmauer der Freien Reichsstadt Nördlingen.
(Schwäbische Geschichtsquellen und Forschungen Bd. 12), Nördlingen
1982, S. 118 f.
einige Stadtmauern gerettet wie die Nördlingens, Nürnbergs,
Rothenburgs ob der Tauber, Dinkelsbühls und einiger Zwerg-
städte im Fränkischen.
Das Werden der Städte
Die Beschreibung Gustav Freytags führt eine urbane Ent-
wicklung von 200 Jahren vor Augen. Man findet solche
Ansichten etwa in der Schedelschen Weltchronik von
1493. Im Frühmittelalter gab es nördlich der Alpen keine
Städte. Herrenhöfe, Dörfer oder Weiler, auch Klöster und
Domkirchen waren kaum befestigt. Das änderte sich im
späten 9. und 10. Jahrhundert angesichts der Bedrohun-
gen durch Wikinger und Ungarn. Befestigter Schutz wurde
lebenswichtig. In den Quellen werden befestigte Ansied-
lungen als
civitas
oder
urbs
bezeichnet
.
Gewöhnlich wird
das mit „Stadt“ übersetzt. Aber gemeint sind der Bezirk um
einen Dom und Bischofssitz, eine Klosterimmunität, eine
Königspfalz oder die Burg eines hochadligen Geschlechts.
Eine solche Situation lag in Augsburg vor, als die Ungarn
955 die
civitas
belagerten. Aus dem „Leben des hl. Ulrich,
Bischof von Augsburg“
4
von Domprobst Gerhard erfahren
wir Details über die Stadtbefestigung. Augsburg sei „damals
nur von niedrigen Mauern ohne Türme umgeben“ gewesen
und die Tore hätten nur schwach Schutz gehabt. Gerhard
spricht von
murus
, „Mauer“, was hier aber besser mit „Wall“
zu übersetzen ist. Denn Bischof Ulrich befiehlt, nachdem
der erste Ansturm abgewehrt worden war, die hölzernen
Palisaden zu erneuern, die nur auf einem Erdwall stehen
konnten. Selten erhalten wir aus einer zeitnahen Quelle so
detaillierte Angaben über frühe Stadtbefestigungen.
5
Die
derart geschützte
civitas
war der Dombezirk, ein Areal von
etwa 620 x 300 Meter. Ungewöhnlich früh, nämlich noch
zur Zeit Ulrichs († 973), erhielt diese Stadt oder Bischofs-
burg tatsächlich eine Mauer anstelle des Walls.
Die Urbanisierung begann in Deutschland zaghaft im
11. Jahrhundert.
6
Ein demografisches Wachstum belebte
4 Vita Sancti Oudalrici Augustani. (Ausgewählte Quellen zur Geschichte des
Mittelalters, Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe, Bd. 22). Darmstadt
1986, S. 45–157; Zitat S. 104 f.: Lateinisch-Deutsch.
5 Vgl. Walter Groos: Augsburg zur Zeit Bischof Ulrichs. In: Zeitschrift des
Historischen Vereins für Schwaben, Bd. 67, 1973, S. 39–47, und Georg
Kreuzer: Augsburg in fränkischer und ottonischer Zeit. Augsburg als
Bischofsstadt unter den Saliern und Staufern. In: Gunther Gottlieb u.a.
(Hg.): Geschichte der Stadt Augsburg von der Römerzeit bis zur Gegen-
wart, Stuttgart 1984, S. 116–121.
6 Zur Stadtentwicklung vgl. Werner Goez: Werden und Bedeutung der
deutschen Stadt im Mittelalter. In: Norbert Fuchs/ders. (Hg.): Die Stadt
im Mittelalter. (Arbeitsmaterialien für den Geschichtsunterricht 11. Jahr-
gangsstufe), München 1977, S. 5, und Bernd Fuhrmann: Hinter festen
Mauern. Europäische Städte im Mittelalter, Darmstadt 2014, S. 81–100.


















