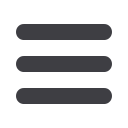

41
Einsichten und Perspektiven 4 | 15
Stadtmauer und Bürger
Durch die Errichtung von Stadtmauern im 12./13. Jahr-
hundert wurde ganz augenscheinlich dokumentiert, was
zur Stadt gehörte und was nicht. So kam es zur begriffli-
chen Trennung von Stadt und Land.
9
Noch im 11. Jahr-
hundert wurde zwischen Burg und Stadt kaum unter-
schieden. Nun wurde
Stadt
zu einer eigenen Kategorie: ein
vergleichsweise bevölkerungsreiche Ansiedlung mit einem
Markt, einer eigenen Rechtsordnung und einer Schutz-
mauer.
Da die Wehrhaftigkeit zur Stadt gehörte, hielt sich
der Begriff „Burger“ oder „Bürger“
10
zur Unterscheidung
der Stadtbewohner von der Landbevölkerung. Und diese
Unterscheidung war bedeutsam! Außerhalb der Mauern
lebten die bäuerlichen Hintersassen von Adel und Kirche
in verschiedenen Formen der Hörigkeit, dienst- und abga-
benpflichtig. Hinter den Mauern herrschte Sicherheit und
ein höheres Maß an Freiheit. „Stadtluft macht frei“ – die
berühmte Formel stammt zwar von Jakob Grimm aus dem
19. Jahrhundert, gibt aber ein Rechtsprinzip wieder, das
sich in zahlreichen Stadtprivilegien findet.
11
Eine Person
war frei von früheren Abhängigkeiten, wenn sie sich eine
bestimmte Zeit unbehelligt in der Stadt aufgehalten hat;
das galt auch für die Nachkommen. Die Stadt schützte
diesen Menschen: durch die Mauern vor Übergriffen von
außen und durch den Eintritt in eine neue Rechtsord-
nung. Die Städte boten eine höhere Lebensqualität und
Hoffnung auf sozialen Aufstieg – sonst ist deren Anzie-
hungskraft nicht zu erklären. Auch die Stadtherrn (König,
Bischöfe, Fürsten) hatten ein Interesse amWachstum ihrer
Städte; nur sollten es nicht die eignen Hintersassen sein,
die abwanderten. Das höhere Maß an Freiheit und Sicher-
heit gab es nicht umsonst. Jeder musste zum gemeinen
Wohl beitragen, nicht zuletzt zum Bau und Unterhalt der
Mauer, sei es durch Geld oder Arbeitskraft. Jeder wehr-
fähige Mann stand im Ernstfall auf der Mauer, um seine
Stadt zu verteidigen. Die Stadtmauer war das Symbol für
den Preis der Freiheit.
9 Vgl. Fuhrmann (wie Anm. 6), S. 93.
10 Aus ahd.
burgāri
,
burgeri
(9. Jh.), mhd.
burgære
,
burger
„Bewohner einer
Burg, einer Stadt“. Die Ausgangsbedeutung von „Bürger“ wäre danach
„Burgverteidiger“, daraus entwickelt sich „Bewohner einer Burg, einer
Stadt, eines Staates“. Im Zusammenhang mit der Herausbildung der
deutschen Städteverfassungen im 11./12. Jh. bezeichnet „Bürger“ das
freie, vollberechtigte Mitglied einer Stadtgemeinde.
http://www.dwds.
de/?qu=B%C3%BCrger [Stand: 25. November 2015].
11 Vgl. Goez (wie Anm. 6), S. 7, und Heinrich Mitteis: Über den Rechtsgrund
des Satzes „Stadtluft macht frei“. In: Carl Haase (Hg.): Die Stadt des Mit-
telalters, Bd. 2: Recht und Verwaltung,
2
Darmstadt 1976, S. 182–202.
Stadterweiterung und Stadtwerdung
Da die Befestigung teuer war, durfte ein Mauerumgriff
nicht zu klein ausfallen, sonst war über kurz oder lang
eine Erweiterung und ein Neubau nötig. Umschloss man
aber ein zu großes Areal, dann fehlte es an wehrfähigen
Bürgern. Es gibt Berechnungen, wonach ein Mann etwa
1,5 m einer Wehranlage verteidigen konnte.
12
Gelegentlich haben Städte mit einem enormen Bevölke-
rungszuwachs kalkuliert, als sie den Verlauf des Mauergür-
tels festlegten. Goslar
13
am Harz – reich geworden durch
den Silberbergbau am Rammelsberg – baute ab etwa 1100
eine über sechs Kilometer lange Mauer, die etwa 84 Hektar
umschloss. Das war ein derart großzügiger Umgriff, dass
auch nach 40 Jahren noch große Brachen übrig blieben. Als
sich 1552 der Herzog von Braunschweig des Silberbergbaus
bemächtigte, schwand mit dem Wohlstand auch die Zahl
der Bewohner. Ulm
14
war erfolgreicher: Die Stadt an der
Donau besaß seit den 1220er Jahren eine Mauer und hatte
Anfang des 14. Jahrhunderts ca. 5.000 Einwohner, als der
Rat beschloss, eine neue Mauer zu bauen. Deren Verlauf
legte man weit ins unbebaute Gelände hinaus und vervier-
fachte die ummauerte Fläche auf 66,5 Hektar – Raum für
mindestens 20.000 Einwohner, was Ulm in den Kreis der
größten deutschen Städte hob. Gut 200 Jahre später wurde
die Zahl tatsächlich erreicht – dank einer Tuchproduktion
(Barchent) von europäischem Rang.
Eine solche Planung war aber selten. Die Regel war eher
das Einbeziehen von Vorstädten und die Vereinigung von
Doppelstädten hinter einer gemeinsamen Mauer. Natürlich
wurde immer auch unbebautes Gelände mit eingeschlossen.
In Nürnberg
15
entwickelte sich aus einer Marktsied-
lung südlich der Burg im 12. Jahrhundert die Sebalder
Stadt (nach der Hauptkirche St. Sebald). Um 1140 grün-
dete der erste Staufer-König Konrad III. südlich davon
und jenseits der Pegnitz die Lorenzer Stadt. Beide Teile
12 Vgl. Stadt im Wandel. Kunst und Kultur des Bürgertums in Norddeutsch-
land, (Landesausstellung Niedersachsen 1985), Stuttgart/Bad Cannstadt
1985, Bd. 3, S. 86.
13 Vgl. Stadt im Wandel (wie Anm. 12), Bd.1, S. 125ff., und H.G. Griep: Aus-
grabungen und Bodenfunde im Stadtgebiet Goslar. In: Harz-Zeitschrift
1983, S. 1–54; vgl. Hans-Günther Griep: Führer durch Goslar, Bd. 5, Die
Befestigungsanlagen, Goslar 1992.
14 Vgl. Hans Eugen Specker: Reichsstadt und Stadt Ulm. In: Der Stadtkreis
Ulm. Ulm 1977, S. 38–42, und Herbert Wiegandt: Ulm. Geschichte einer
Stadt, Weißenhorn 1977, S. 59–84.
15 Vgl. Georg Dehio: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, Bayern I:
Franken. München 1979, S. 541–545 und 611–614, sowie Mittelalterliche
Stadtentwicklung (KPZ im Germanischen Nationalmuseum), Nürnberg
1982.
Nuernberginfos.de/bauwerke-nuernberg/stadtbefestigung-nuern-berg.html [Stand: 17.01.2015].


















