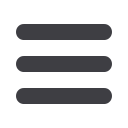

44
Eine Mauer für Freiheit und Sicherheit
Stadtansichten aus der frühen Neuzeit zeigen noch einige
Türme; der letzte wurde nach dem Dreißigjährigen Krieg
abgerissen. Die zweite Mauer stellt eine konzentrische
Erweiterung dar.
Eine Mauer bauen
An der Nördlinger Stadtmauer
20
können einige Fragen
exemplarisch beantwortet werden, etwa nach der Rolle
des Stadtherrn, in diesem Fall des Königs, oder nach der
Finanzierung. Auch die Gestalt der Befestigung ist bei-
spielhaft wie ihre militärische und politische Funktion.
Wir wissen nicht, ob die Nördlinger von sich aus um
ein Privileg gebeten haben. In der einschlägigen Urkunde
vom 3. Mai 1327 erscheint König Ludwig der Bayer als
Initiator. Er befahl dem Rat und allen Bürgern, die um
die Stadt herum gelegenen großen Vorstädte aus Gründen
der Sicherheit in einen neuen Verteidigungsring einzube-
ziehen. Dieser soll aus Graben, Mauer und anderen Befes-
tigungswerken bestehen. Zur Finanzierung gewährte der
König – wie zuvor in Nürnberg und Rothenburg – acht
Jahre lang ein „Ungeld“ zu erheben, eine Verbrauchssteuer
auf alkoholische Getränke wie Wein und Bier. Das Geld
müsse zweckgebunden verwendet werden, sonst werde es
der König von der Stadt fordern und das Steuerprivileg
widerrufen.
21
Der König genehmigt oder befiehlt also den
Bau einer Stadtmauer, lässt aber viel Spielraum. So sagt
das Privileg nicht, wann der Festungsbau als beendet zu
betrachten ist.
Mit demBau der neuenMauer wurde noch 1327 begon-
nen. Geschlossen war der Ring wohl 1390. Die Stadt stritt
damals mit den Grafen von Oettingen, den mächtigen
Territorialherrn im Ries. Diese sahen durch den Abschluss
des Mauerbaus ihre Gerichtshoheit beschnitten, die bis an
die Grenze der alten Mauer gereicht hatte. Dies zeigt: Erst
die neue Mauer machte die Menschen in den Vorstädten
zu Nördlinger Bürgern. Dass man die innere Mauer erst
niederlegte, als die äußere fertig war, liegt bei diesen Span-
nungen auf der Hand.
Für ein Jahrhundertwerk reichte die vom König geneh-
migte Finanzierung natürlich nicht aus, zumal der Bau an
der Mauer eigentlich nie endete: Man besserte aus, ver-
stärkte, brach baufällige Türme ab und baute neue. Die
Getränkesteuer wurde nach acht Jahren nicht abgeschafft,
20 Vgl. Dietmar-H. Voges: Die Reichsstadt Nördlingen. 12 Kapitel aus ihrer
Geschichte, München 1988, S. 94–119, und Gustav Zipperer: Nördlingen.
Lebenslauf einer schwäbischen Stadt, Nördlingen 1979, S. 21–30.
21 Vgl. Voges (wie Anm. 20), S. 94ff.
sondern verstetigte sich.
22
Auch wurden Strafgelder in
den Mauerbau gelenkt: Jemand musste z.B. eine Fuhre
Steine bezahlen. Ein betuchter Steuerhinterzieher wurde
dazu verurteilt, einen vollständigen Torzwinger mit Brü-
cke zu bauen. Zwischen 1407 und 1448 erhob die Stadt
ein „Grabengeld“ (befristet wie ein Solidaritätszuschlag).
Kosten verursachten nicht nur die großen Mengen an
Material (Hau- und Bruchsteine, Ziegel, Holz). Man
brauchte auch erfahrene Baumeister, die sich in der immer
anspruchsvolleren Befestigungskunst auskannten.
Natürlich war der Aufbau einer Stadtbefestigung bis zu
einem gewissen Grad variabel. Er konnte von den topo-
grafischen Gegebenheiten abhängen. In Rothenburg zum
Beispiel war das tief in den Muschelkalk eingeschnittene
Taubertal mit seinen steilenHängen ein natürlicher Schutz,
der an der Westseite eine Reduzierung der Wehrbauten
erlaubte. Es ging immer darum, welcher Bedrohung die
Mauer standhalten sollte. Wachtdienste und Schließen
der Tore am Abend sollten einen Handstreich verhindern.
Bei einer Belagerung musste man mit dem Versuch rech-
nen, die Mauer zu erstürmen. Das geschah mit Leitern
oder es wurden hölzerne Belagerungstürme herangeführt,
von denen aus man die Mauer übersteigen konnte. Mit-
telalterliche Mauern mussten deshalb hoch sein; in Nörd-
lingen sind es bis zu 9,5 Meter. Es gab Rammböcke, um
die Tore aufzubrechen, und Wurfmaschinen, Steinschleu-
dern, mit denen Breschen in die Mauer geschossen oder
Verwüstungen in der Stadt angerichtet werden konnten.
Notwendig waren also Vorrichtungen, die verhinderten,
dass der Feind überhaupt an die Mauer herankam. Aus
solchen Szenarien ergab sich ein Grundmuster mittelal-
terlicher Wehranlagen.
Die Nördlinger Mauer besteht in der Hauptsache aus
Bruchsteinen, oben aus Backstein. Rundum verläuft ein
hölzerner, mit einem Ziegeldach geschützter Wehrgang –
im Falle einer Erstürmung der Ort des Nahkampfes. Zur
Feindseite gibt es zahlreiche Rundbogenöffnungen und
Schießscharten. Der Stadtmauer vorgelagert war der
Zwinger. Die Zwingermauer war etwa mannshoch – es
gab also in den meisten Fällen nicht eine, sondern zwei
Mauern. Die Bezeichnung kommt von „bezwingen“.
Hatte der Feind die erste Mauer überwunden, so stand
er in einem Bereich zwischen zwei Mauern und konnte
von oben bekämpft und „bezwungen“ werden. Das Prin-
zip der Doppelmauer wurde schon bei den frühesten
Festungsbauten angewandt. Da die Zwingermauer als
22 Ebd., S. 116 f.


















