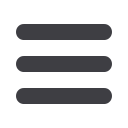

45
Einsichten und Perspektiven 4 | 15
erstes verteidigt wurde, konnte auch sie mit Türmen ver-
sehen sein. Davor verlief der Graben, wodurch die erste
Mauer von außen beträchtlich höher war als von innen.
Der Nördlinger Graben war teils trocken, teils mit Wasser
gefüllt. Vor dem Graben war ein Erdwall aufgeschüttet,
der Palisaden haben konnte. Andernorts gab es auch dop-
pelte Graben-Wall-Systeme oder sogar einen doppelten
Zwinger. Die Mauer war durch fünf Stadttore geöffnet.
Vor den Toren führten Steinbrücken über den Graben, die
jeweils von mehreren Bögen getragen wurden. Das letzte
Stück unmittelbar vor der Mauer bestand aus einer hölzer-
nen Zugbrücke. Schwere hölzerne Torflügel und zusätz-
liche Fallgitter konnten den Zugang abriegeln. Jedes Tor
war durch einen Torturm gesichert. Andere Städte hatten
Flankentürme. Vorwerke, eine Art Burg, schützten Brü-
cke und Tor schon im Vorfeld. Die Türme kragten aus
der Stadtmauer heraus, um tote Winkel zu vermeiden.
Besonders stark und auch mit Vorwerken versehen waren
der Untere und der Obere Wasserturm. Denn wo die Eger
hinein- oder aus der Stadt herausfloss, war eine verwund-
bare Stelle. Über den Graben wurde der Fluss durch einen
hölzernen Trog geleitet.
In welchen Bauabschnitten die Mauer in Nördlingen
errichtet wurde, ist nicht bekannt. Vielleicht ist man ähn-
lich vorgegangen wie die Ulmer beim Bau ihrer fast drei-
einhalb Kilometer langen Mauer (etwa ab 1316). Aller-
dings hatten diese es besonders eilig, weil sie damals im
Konflikt mit Ludwig dem Bayern lagen, denn sie hatten
als einzige Stadt Schwabens bei der Doppelwahl 1314
den Habsburger Friedrich den Schönen unterstützt. Die
Ulmer hoben zuerst einen Graben aus und füllten ihn
mit Wasser der Blau. Mit dem Aushub wurde ein Wall
aufgeworfen. Gleichzeitig bauten sie eine einfache Mauer
mit Toren, vier großen und einigen kleinen Türmen. Das
alles geschah in großer Eile unter Beteiligung aller Bewoh-
ner, Patrizier und einfachen Leute, Männer und Frauen.
Gleich nach Fertigstellung dieses Bauabschnitts wurde
eine zweite Mauer errichtet, die eigentliche Stadtmauer.
Sie verlief fünf bis sechs Meter innerhalb der ersten, die
somit zur Zwingermauer wurde. In einem dritten Bauab-
schnitt wurde der Schutz der Tore verstärkt.
23
Die Mauer – ein Bauwerk für die Freiheit
Viele kleine Städte konnten keinen Festungsbau betreiben,
um einen wirklich starken Feind abzuwehren. Die Mauer
ermöglichte, zu kontrollieren, wer die Stadt betrat. Man
konnte sich vor den Fehden adliger Nachbarn schützen
oder einer Belagerung kurzzeitig standhalten, bis Hilfe
23 Vgl. Herbert Wiegandt: Ulm. Geschichte einer Stadt. Weißenhorn 1977,
S. 60 f., und Hans Eugen Specker: Reichsstadt und Stadt Ulm. In: Der
Stadtkreis Ulm, Ulm 1977, S. 41.
Deininger Torturm und die Mauer zwischen Löpsinger und Deininger Tor in
Nördlingen. Mittelalter und Gegenwart: Im ehemaligen Graben sind Gärten
angelegt. Wo einst der Zwinger war, stehen kleine Häuschen; sie haben die
Stadtmauer als Rückwand. Auf dem einstigen Wall verläuft ein Fußgängerweg.
Foto: Siegfried Münchenbach
Wehrgang der Nördlinger Stadtmauer zwischen Löpsinger Tor und Unterem
Wasserturm
Foto: Siegfried Münchenbach


















