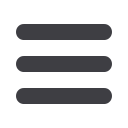

42
Eine Mauer für Freiheit und Sicherheit
prosperierten und erhielten um die Mitte des 13. Jahr-
hunderts je eine Mauer. Zwischen den Stadthälften verlief
das Tal der Pegnitz mit Schwemmland und Sumpf, zum
Teil Wohnbereich der jüdischen Gemeinde. 1320 ent-
schloss sich der Rat, die Sebalder und Lorenzer Seite zu
vereinen. Dafür musste man den Fluss mit einer Mauer
überspannen. Eine spätere Erweiterung (bis 1450) schloss
Vorstädte ein und schuf den gut fünf Kilometer langen
äußeren Mauerring, der noch weitgehend erhalten ist. Der
entscheidende Schritt für die urbane Entwicklung war die
Vereinigung der Teilstädte hinter einem Mauerring. Nun
konnte man an den inneren Ausbau gehen und die Fluss-
niederung zu einem neuen Zentrum entwickeln.
Es war ein Vorgang, den man häufig finden kann: In
Quedlinburg vereinigten sich etwa ab 1330 Alt- und Neu-
stadt durch den Bau einer gemeinsamen Mauer. Rostock
entstand 1265 durch eine gemeinsame Mauer um drei
Teilstädte. Braunschweig
16
ist sogar aus fünf Weichbildern
zusammengewachsen – Altewiek, Altstadt, Hagen, Neu-
stadt und Sack –, die unabhängig voneinander gegründet
worden waren, sich regierten und je eine Mauer besaßen.
Im 13. Jahrhundert baute man eine gemeinsame Mauer
und etablierte einen gemeinsamen Rat.
16 Vgl. Stadt im Wandel (wie Anm. 12), Bd. 1, S. 56–59.
Hier wie in vielen anderen Fällen war die Mauer eine
wesentliche Voraussetzung für die Stadtwerdung: Sie
vereinigte verschiedene Siedlungskerne oder Teilstädte,
bestimmte die Grenzen von Plangründungen und integ-
rierte Vorstädte. Die Mauer definierte die Stadt, und sie
war eine Gemeinschaftsaufgabe, die andere nach sich zog,
weil man einen begrenzten Raum sinnvoll verwalten und
das Zusammenleben organisieren musste. Das reichte von
Bauordnungen und der Gestaltung des öffentlichen Rau-
mes über Feuerschutz und Vorschriften zur Tierhaltung
bis zur Gewährleistung der Verteidigungsbereitschaft. Für
all das war die Mauer real und sinnbildlich eine Klam-
mer und dadurch eine Voraussetzung für die Entwicklung
eines gemeinsamen Bürgersinns, einer lokalen Identität.
Alte und neue Mauern
Rothenburg und Nördlingen sind Beispiele dafür, dass
Stadterweiterungen vorgenommen wurden, um unge-
schützte Vorstädte zu integrieren. Dabei sind die altenMau-
ern nicht einfach verschwunden: Sie haben – wie andern-
orts auch – ihre Signatur in den Stadtplänen hinterlassen.
Die Stadt Rothenburg
17
entwickelte sich von der Burg
her, die auf einem Felssporn hoch über dem Taubertal
17 Vgl. Dehio (wie Anm. 15), S. 720 f., S. 730 f.
Stadtansicht von Nürnberg. Kolorierter Holzschnitt von Michael Wolgemut aus der Schedelschen Weltchronik von 1493
Foto: ullstein bild – histopics


















