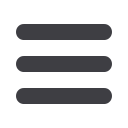

46
Eine Mauer für Freiheit und Sicherheit
kam. Eine Stadt wie Nördlingen hatte größere Ambitionen.
Mit gut 6.000 Einwohnern im 15. Jahrhundert gehörte
es zu den mittelgroßen Städten, produzierte z.B. Tuche,
Loden und Barchent für einen überregionalen Markt, besaß
Münzrecht, hatte nachweisbar seit 1219 eine Pfingstmesse,
die mit der Zeit die Stadt zu einem wichtigen Fernhandels-
platz in der Südhälfte Deutschlands machte. Wenn Nörd-
lingen eine Mauer baute, dann ging es um die Freiheit der
Stadtrepublik und den Wohlstand ihrer Bürger.
Die Bedrohungen waren sehr konkret. Für die Grafen
von Oettingen hätte die Herrschaft über Nördlingen eine
Arrondierung ihres Machtbereichs bedeutet. Auch die
bayerischen Herzöge, die durch Pfandschaften in dem
Raum Fuß gefasst hatten, haben einen begehrlichen Blick
auf die Reichsstadt geworfen. Um seine Freiheit zu vertei-
digen, hat sich Nördlingen nicht nur auf seine Mauer ver-
lassen. Dutzende Male war die Stadt vom 14. bis ins 16.
Jahrhundert mit eigenen Truppen an Kriegen und Fehden
beteiligt.
24
Die Reichsstadt stellte König und Kaiser Kon-
tingente zur Verfügung, die aus angeworbenen Söldnern,
aber auch aus Bürgern bestanden. Als Kaiser Friedrich III.
1474 gegen Herzog Karl den Kühnen von Burgund Krieg
führte, gehörten die Nördlinger zusammen mit anderen
Städten zu den ersten, die bereit standen, das belagerte
Neuß zu entsetzen. Der Kaiser belohnte die Städte mit
einem Privileg, das ihnen erlaubte, ihre Befestigungen
auszubauen, mit „Gräben, Vorwerk, Zeun, Pastein, Turen,
Planken und Schranken“.
25
Besonders der Hinweis auf
Basteien ist bemerkenswert.
Nördlingen engagierte sich im Reichsdienst, bei der
Wahrung des Landfriedens (so zog man 1521 gegen die
fränkischen Raubritter) und schloss immer wieder Bünd-
nisse mit anderen Reichsstädten. Im Städtekrieg (1449–
1453) zog die Allianz schwäbischer Reichsstädte u.a.
gegen die Grafen von Oettingen und von Württemberg,
die Markgrafen von Brandenburg-Ansbach, die Herzöge
von Bayern. Bei diesen und vielen anderen Unternehmun-
gen wurde die Nördlinger Stadtmauer nicht auf die Probe
gestellt. Aber sie war die Voraussetzung dafür, bündnis-
fähig zu sein und in der Reichspolitik eine Rolle zu spie-
len. Nördlingen half dem Kaiser und unterstützte die
Bündnispartner, um im Ernstfall mit deren Hilfe rechnen
zu können. Zweimal musste die Nördlinger Stadtmauer
einem mächtigen Feind standhalten.
26
Herzog Georg der
24 Vgl. Voges (wie Anm. 20) , S. 220–227.
25 Zit. nach Zipperer (wie Anm. 20) S. 23.
26 Vgl. ebd., S. 74 f., Voges (wie Anm. 20), S. 224f.
Reiche von Bayern-Landshut erschien 1471 und 1485 mit
Heeresmacht vor der Stadt, beim zweiten, gefährlicheren
Angriff mit 700 Berittenen und 5.000 Fußsoldaten, um
die Stadt aus nichtigem Anlass in die Knie zu zwingen.
Nach sechs Wochen Belagerung zog er auf Druck Kaiser
Friedrich III. ab.
Das Wettrüsten
Es gibt Momente, in denen sich Vorzüge ins Gegenteil
verkehren. Die hohen und nicht allzu dicken mittelal-
terlichen Stadtmauern waren schwer zu übersteigen. Für
weitreichende und präzise Artillerie waren sie hingegen
ein leichtes Ziel. Feuergeschütze gab es schon im 14. Jahr-
hundert, schwerfällige Mörser und Bombarden, gut für
Zufallstreffer. Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts änderte
sich das; es war mit neuer Waffentechnik zu rechnen, und
im 16. Jahrhundert musste eine Stadt ganz anders vertei-
digt werden als im Mittelalter.
27
1449 baute Nördlingen das erste Bollwerk
,
um Defen-
sivartillerie in Stellung zu bringen. Die Alte Bastei
28
erhielt
aber erst im 16. Jahrhundert ihre endgültige Gestalt. Sie
schützte die Stadt an der Stelle, an der das Gelände zur
Schwäbischen Alb ansteigt. Dort konnte sich feindliche
Artillerie verschanzen; eine Schwachstelle war entstan-
den, für die die mittelalterliche Mauer nicht gerüstet
war. Es galt, die Angriffsartillerie zu bekämpfen und auf
Distanz zu halten. Schon im späten 15. Jahrhundert ist
an der Verstärkung von Toren, Vorwerken und Türmen
gearbeitet worden, um dort Geschütze aufstellen zu kön-
nen. Die meisten solcher Bauten stammen aber aus dem
16. Jahrhundert. In Nördlingen wurden beispielsweise
am Löpsinger Torturm und am Feilturm nahe der Alten
Bastei die oberen Stockwerke abgetragen und durch dick-
wandige Zylinder ersetzt, die Kanonen tragen und von
der feindlichen Artillerie nicht so frontal getroffen wer-
den konnten wie die Türme auf quadratischem Grundriss.
Nürnberg hat 1556–64 die vier gotischen Tortürme der
äußeren Mauer vollständig rund ummantelt – heute noch
ein imposanter Anblick. Bei der Vorbereitung auf den
Festungskrieg war nicht nur in Bauwerke zu investieren,
sondern auch in eine Artillerie mit immer größerer Reich-
weite und Zielgenauigkeit. Die Zahl der Städte nahm ab,
die bei diesem Wettrüsten mithalten konnte.
In Nördlingen wurde die mittelalterliche Mauer zu
Beginn des 17. Jahrhunderts ein letztes Mal durch eine
27 Vgl. Bondt (wie Anm. 18), S. 121–139.
28 Vgl. Voges (wie Anm. 20), S. 113 f., und Kessler (wie Anm. 3), S. 54–57.


















