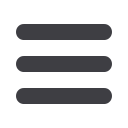

28
Das deutsch-italienische Anwerbeabkommen vom 20. Dezember 1955
Einsichten und Perspektiven 4 | 15
Verantwortlichen entschieden sich in dieser Situation früh
für eine möglichst weitgehende außenwirtschaftliche Öff-
nung in Richtung Europa. Dies mündete zunächst in der
Teilnahme Italiens am
European Recovery Program
(ERP),
damit auch an der die Marshallplan-Hilfe koordinierenden
Organization for European Economic Cooperation
(OEEC)
sowie später der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.
6
Ein grundlegendes Problem bei der außenwirtschaftlichen
Öffnung Italiens stellte die bis 1958 fehlende Konvertibilität
aller europäischen Währungen dar. Eine Währung ist immer
dann konvertibel, wenn sie unbegrenzt in andereWährungen
umgetauscht und in das Ausland transferiert werden kann. Da
den europäischen Ländern zu jener Zeit noch die Devisen-
polster fehlten, um die Konvertibilität zu garantieren, stellten
die Währungen reine Binnenwährungen dar. Einzig die US-
amerikanischeWährung wurde von allen Ländern akzeptiert;
allerdings war der Dollar durch die unterbrochenen transat-
lantischenHandelsströme nach 1945 in nicht ausreichendem
Maße in Europa vorhanden („Dollar-Lücke“). Unter diesen
Bedingungen musste der Zahlungsausgleich durch bilaterale
Handelsverträge, die den Außenhandel quasi zu Natural-
tausch degradierten, ersetzt werden. Solche Handelsgeschäfte
der Regierungen erfordern individuelle Verträge mit jedem
Handelspartner und einen zwischen den jeweiligen Handels-
partnern wertmäßig weitestgehend ausgeglichenen Handel.
„Jedes Land kann mittelfristig nur so viel aus einem ande-
ren Land beziehen, wie es dort abzusetzen vermag. Nun
sind aber die wechselseitigen Bedürfnisse zweier Länder
einander nicht notwendigerweise quantitativ gleich. [...]
Da die Differenzen gar nicht oder nur sehr eingeschränkt
mit Geld ausgeglichen werden können, bleibt der interna-
tionale Handel hinter den Bedürfnissen zurück.“
7
Mit der seit 1950 arbeitenden Europäischen Zahlungs-
union (EZU) einigten sich die Mitgliedsländer der OEEC
8
deshalb auf eine multilaterale Verrechnung der Handelsbi-
lanzsalden auf Dollar-Basis und den Ausgleich temporärer
Defizite über streng limitierte Kredite. Das Land, das bei
der Verrechnung
(„Clearing“)
ein Handelsbilanzdefizit auf-
6 Vgl. hierzu insgesamt: Augusto Graziani: L’economia italiana dal 1945 a
oggi, Bologna 1979, S. 13–74; Ennio Di Nolfo: Das Problem der europäi-
schen Einigung als ein Aspekt der italienischen Außenpolitik 1945–1954,
in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 28 (1980), S. 145–167.
7 Volker Hentschel,: Die Europäische Zahlungsunion und die deutschen De-
visenkrisen 1950/51, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 37 (1989),
S. 715–758, hier S. 719 f.
8 Gründungsmitglieder der OEEC waren Österreich, Belgien, Dänemark,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Norwegen, die
Niederlande, Portugal, das Vereinigte Königreich, Schweden, die Schweiz
sowie die Bundesrepublik Deutschland.
wies, erhielt einen Kredit von der Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich (BIZ). Allerdings wurden die Kredite mit
Auflagen verbunden, was im Hinblick auf den Außensaldo
disziplinieren sollte: Mit jeder Kredittranche wuchs die Ver-
pflichtung zur Rückzahlung in Gold oder Dollar, welche
ausdrücklich durch den Export erwirtschaftet worden sein
mussten. Bei den Gläubigern kam es zu gegensätzlichen
Verpflichtungen, das heißt, dass die EZU auch in Ländern
mit Handelsüberschuss Maßnahmen zur Überwindung der
Zahlungsbilanzungleichgewichte erzwang. Für den Wie-
deraufbau Europas, die Rekonstruktion der europäischen
Arbeitsteilung, musste nämlich unbedingt vermieden wer-
den, dass ein Land ausschließlichWaren importiert, während
ein anderes Land im Gegenzug ausschließlich Devisen hor-
tet. In der Folge nahm der innereuropäische Handel schnell
zu und mit ihm die für eine Konvertibilität unabdingbaren
Währungsreserven der Zentralbanken. Der Übergang zur
freien Konvertierbarkeit der Währungen, der mit der Auf-
lösung der EZU verbunden war, erfolgte im Jahr 1958.
9
Neben Devisenmangel und fehlender Konvertibilität
sahen sich die italienischen Regierungen schließlich auch
noch mit einem rapiden Bevölkerungswachstum konfron-
9 Vgl. hierzu insgesamt: Barry Eichengreen: Reconstructing Europe’s Trade
and Payments. The European Payments Union, O.O. 1993; sowie: Hent-
schel (wie Anm. 7).
Eine Graphik zur volkswirtschaftlichen Lage der Bundesrepublik verkündet
Optimismus, 13. August 1954.
Foto: ullstein bild


















