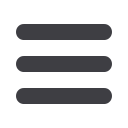

27
Das deutsch-italienische Anwerbeabkommen vom 20. Dezember 1955
Einsichten und Perspektiven 4 | 15
Der Mythos
1
Der Abschluss zwischenstaatlicher Anwerbevereinbarun-
gen und die daraus resultierende Anwerbung ausländischer
Arbeitskräfte durch die Bundesregierungen von 1955
bis zum Anwerbestopp 1973 gilt nicht selten auch in
Fachkreisen noch immer als eine aus den Bedürfnissen
der westdeutschen Industrie resultierende Arbeitsmarkt-
politik. Nach wie vor findet sich die zum Allgemeingut
gewordene, mit archivischen Quellen und zeitgenössi-
scher Literatur jedoch nicht belegbare Annahme aktiver,
von der Bundesrepublik initiierter Anwerbepolitik des-
halb auch in Fachliteratur jüngeren Datums. Erst langsam
konnte sich deshalb in der Forschung die diese Auslegung
zunächst nur partiell korrigierende Ansicht durchset-
zen, die Anwerbeabkommen seien daneben
auch
infolge
außenpolitischer Belange zustande gekommen.
2
Die systematische Sichtung nicht nur der Akten des Bun-
desarbeits- und Bundeswirtschaftsministeriums, sondern auch
des Auswärtigen Amtes auf zwischenzeitlich wesentlich ver-
breiterter Quellenbasis zeigt demgegenüber jedoch eine andere
Realität. Demnach ging die Initiative zum Abschluss des
deutsch-italienischen sowie aller weiteren Anwerbeabkommen
und damit die Ende 1955 offiziell begonnene Anwerbung aus-
ländischer Arbeitskräfte weder von der Bundesrepublik aus,
noch folgte sie originär arbeitsmarktpolitischen Erwägungen.
Zwar nahm die westdeutsche Industrie im Zeichen des seit
Beginn der 1960er Jahre vollbeschäftigten Arbeitsmarktes die
zusätzlichen Arbeitskräfte in rapide steigender Zahl auf, aber
es waren ausländische Regierungen, die an bundesdeutsche
Ministerien mit der Bitte um Beschäftigung ihrer Staatsbürger
herantraten. Im Fall Italiens hatte es sich noch überwiegend
um außenwirtschaftliche und europapolitische Motive gehan-
delt, die zum Abschluss der deutsch-italienischen Regierungs-
vereinbarung führten. Die folgenden Anwerbevereinbarungen
allerdings waren dann sehr viel deutlicher Ergebnis klassischer
Außenpolitik, bei der die bundesdeutschen Bemühungen um
einen potenziellen NATO-Partner oder um Entspannung im
1 Zu Fehlschlüssen und Mythenbildungen der Migrationsforschung vgl. auch
Johannes-Dieter Steinert: Arbeit in Westdeutschland: Die Wanderungsverein-
barungen mit Italien, Spanien, Griechenland und der Türkei und der Beginn
der organisierten Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte, in: Archiv für Sozi-
algeschichte 35 (1995), S. 197–209, hier S. 197f; sowie zuletzt: Mythen über
die ersten „Gastarbeiter“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 30.09.2015.
2 Vgl. Johannes-Dieter Steinert: Migration und Politik. Westdeutschland –
Europa – Übersee 1945–1961, Osnabrück 1995; sowie beispielsweise auch:
Karolina Novinšćak: Auf den Spuren von Brandts Ostpolitik und Titos Son-
derweg: deutsch-jugoslawische Migrationsbeziehungen in den 1960er
und 1970er Jahren, in: Jochen Oltmer; Axel Kreienbrink, Carlos Sanz Díaz
(Hg.): Das „Gastarbeiter“-System. Arbeitsmigration und ihre Folgen in der
Bundesrepublik Deutschland und Westeuropa, München 2012, S. 133–148
(= Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Bd. 104).
Ost-West-Verhältnis die entscheidende Rolle spielten. Außen-
politische Belange entschieden so auch über die äußere Form,
wie der Fall der nur durch Notenwechsel zustande gekomme-
nen Vermittlungsvereinbarung mit der Türkei zeigt.
3
Im Folgenden sollen Vorgeschichte und Zustandekom-
men der am 20. Dezember 1955 in Rom unterzeichneten
„Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundesrepublik
Deutschland und der Regierung der Italienischen Repub-
lik über die Anwerbung und Vermittlung von italienischen
Arbeitskräften nach der Bundesrepublik Deutschland“
4
skiz-
ziert werden, einschließlich der einschlägigen Diskussionen
innerhalb der Bundesregierung sowie der Standpunkte der
Tarifpartner auf Basis regierungsamtlichen Schriftguts. Um
die initiierende Rolle der italienischen Regierung nachvoll-
ziehen zu können, müssen dafür zunächst die wirtschaftliche
Situation Italiens nach 1945 sowie das seinerzeitige europä-
ische Währungsregime dargestellt werden. Dabei wird auch
ein Blick auf die vorangegangenen italienischen diploma-
tischen Bemühungen geworfen, italienische Staatsbürger
als Arbeitsmigranten in andere Länder reisen zu lassen.
Abschließend wird gezeigt, warum die deutsch-italienische
Anwerbevereinbarung als außenpolitischer Akt europäi-
scher Solidarität interpretiert werden muss.
Der sozio-ökonomische Hintergrund: Devisen-
mangel und Arbeitskräfteüberschuss in Italien,
fehlende Konvertibilität der Währungen in Europa
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stellte Italien
noch immer ein semi-agrarisches Land dar, mit knapp 50
Prozent in der Landwirtschaft Erwerbstätigen und ohne
nennenswerte eigene Rohstoffvorkommen. Insgesamt
bedurfte die italienische Wirtschaft dringend einer über
den Wiederaufbau hinausgehenden Modernisierung. Eine
wie auch immer geartete Modernisierung setzte neben
ausländischem Kapital eine Ausweitung der Importe vor-
aus; außerdem war der italienische Binnenmarkt zu klein,
um einen eigenständigen Entwicklungsprozess zum Tra-
gen kommen zu lassen.
5
Die für Wirtschaft und Politik
3 Vgl. hierzu insgesamt: Heike Knortz: Diplomatische Tauschgeschäfte.
„Gastarbeiter“ in der westdeutschen Diplomatie und Beschäftigungspoli-
tik 1953–1973, Köln/Weimar/Wien 2008.
4 Vgl. Bekanntmachung der Vereinbarung zwischen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland und der Regierung der Italienischen Republik über
die Anwerbung und Vermittlung von italienischen Arbeitskräften nach der
Bundesrepublik Deutschland, in: Bundesanzeiger, 8 (1956), Nr. 11, S. 1–4.
5 Vgl. Michele Salvati: Economia e politica in Italia dal dopoguerra a oggi,
Milano 1984, S. 13–25; Gioachino Fraenkel: Die italienische Wirtschafts-
politik zwischen Politik und Wirtschaft, Berlin 1991, S. 106 (=Volkswirt-
schaftliche Schriften, Heft 414).


















