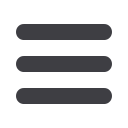
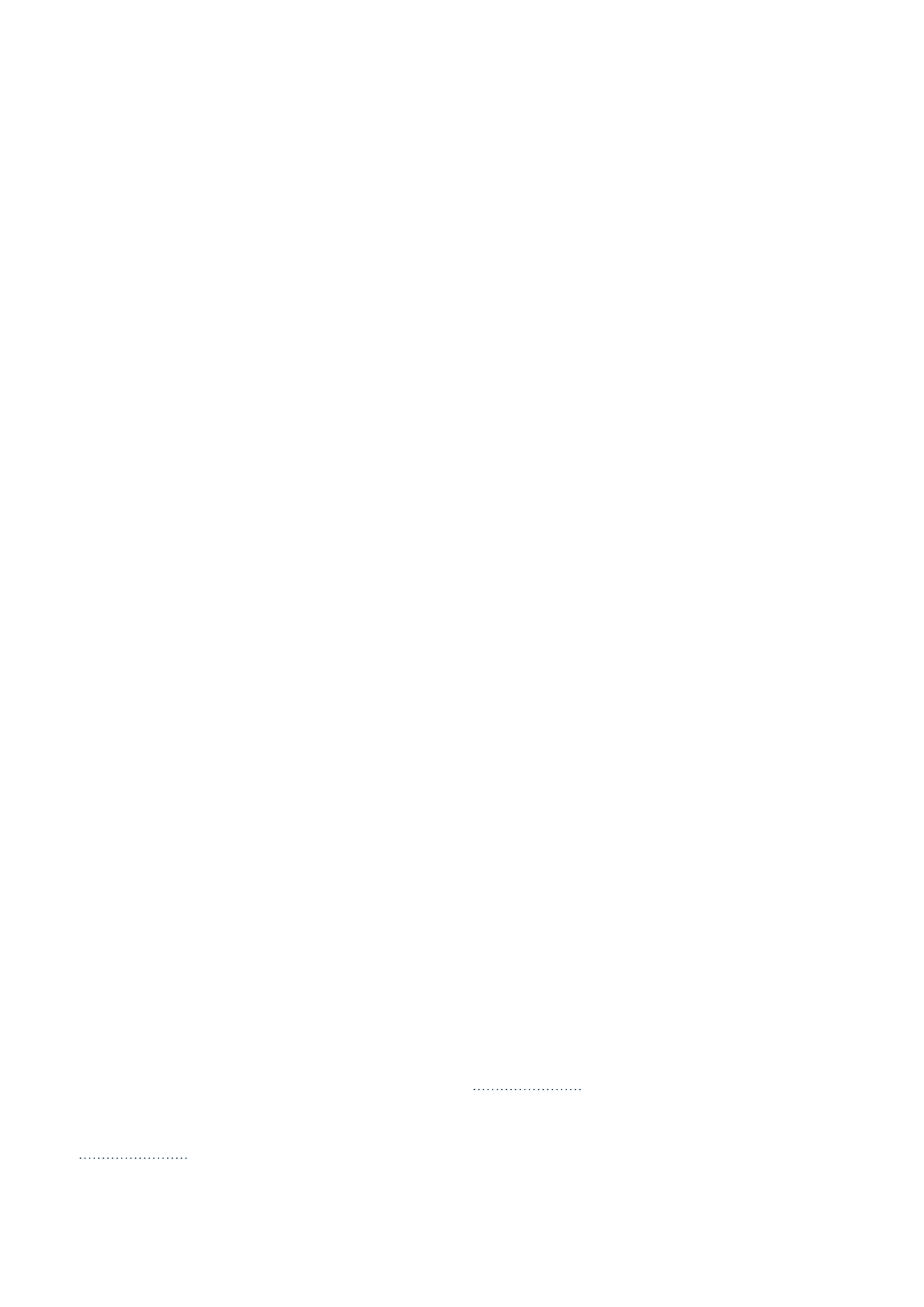
68
Politikfeld Wald
Einsichten und Perspektiven 4 | 16
schriften für den Privatwald in Bayern traditionell liberal
ausgerichtet, da die Idee einer Eigenverantwortlichkeit
des Eigentums innerhalb der politischen Mehrheiten über
lange Zeit auf stabilen Werthalten basiert.
Privatwald imWandel
11
54 Prozent des Waldes in Bayern befinden sich in priva-
tem Besitz von ca. 700.000 Waldbesitzern.
Der Waldbesitz verteilt sich jedoch nicht gleichmäßig
auf die Eigentümer, sondern folgt einer typischen Lorenz-
kurve. 56 Prozent der Waldbesitzer nennen weniger als
einen Hektar ihr Eigen. Häufig ist die Fläche parzelliert.
Insgesamt gehören diesen Waldbesitzern acht Prozent der
Fläche. Drei Prozent der Waldeigentümer besitzen mehr
als 20 ha. Dieser Gruppe gehört ein Drittel des Privatwal-
des. Ein weiteres Drittel ist im Eigentum von Waldbesit-
zern, die zwischen zwei und fünf ha Wald besitzen.
Das Waldeigentum war in der Vergangenheit auch für
die Kleinstwaldbesitzer (Flächen <2ha), die heute fast zwei
Drittel der Waldbesitzer stellen, eine wichtige meist ener-
getische Ressource. Das Eigentum war in der Regel mit
landwirtschaftlichen Betrieben verbunden. Durch den
Agrarstrukturwandel (insbesondere der Konzentration
der landwirtschaftlichen Produktion auf immer weniger
Betriebe) werden Flächen aus der Landwirtschaft ver-
pachtet oder verkauft. Wald bleibt dagegen weitestgehend
regelmäßig im Eigentum der Waldbesitzer.
1. Ressourcenverfügbarkeit
Aus einer technisch-ökonomischen Perspektive ergibt sich
das Phänomen, dass in diesen Kleinsteigentumswäldern
deutlich weniger Substanz genutzt wird als nachwächst.
Das natürliche, standörtliche Nutzungspotenzial wird
somit nicht ausgeschöpft. In unterschiedlichen Unter-
suchungen zeigt sich, dass sich die Waldeigentumsgroße
wesentlich auf das Verhalten der Waldeigentumer aus-
wirkt. Oft haben gerade diese kleineren Flachen unklare
Grenzen, ihre Grundstücke sind parzelliert, die Grundstü-
cke nicht oder nur schlecht mit Wegen erschlossen und sie
weisen eine ungunstige Gelandebeschaffenheit auf. Das
Argument „lohnt sich nicht“ lässt sich bei diesen Verhält-
nissen fast immer gegen eine Bewirtschaftung von kleinen
Waldflachen anführen. Es bedarf im Kleinstwaldbereich
daher der Entwicklung entsprechender, besitzübergreifend
wirksamer Strukturen, die eine Verfügbarkeit des Rohstof-
11 Vgl. Stefan Schaffner: Realisierung von Holzvorräten im Kleinprivatwald,
Freising 2001.
fes Holz garantieren oder zumindest denkbar erscheinen
lassen.
2. Änderung der Mentalität
Ein großerTeil der Kleinstprivatwaldbesitzer hat den Bezug
zur Landwirtschaft und Urproduktion über die Generati-
onen verloren. Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, den
Wald zu bewirtschaften, nehmen deutlich ab. Aus der
sozialen Perspektive folgen diese Waldbesitzer nicht mehr
den traditionellen konservativen Werten, die sich in bäu-
erlichen Betrieben entwickelt haben, sondern sind heute
ein Abbild der gesamten Breite gesellschaftlicher Wert-
systeme. Waldbesitzer lassen sich mithin immer weniger
einem bestimmten Milieu zuordnen, sondern decken die
gesamte Bandbreite ab. Das forstliche Umfeld bezeichnet
diese Gruppe mit der Begrifflichkeit „urbaner“ Waldbesit-
zer. Dieses Bild eines „Städters“ verschleiert jedoch, dass
es sich keineswegs um eine homogene Gruppe handelt,
sondern dass unter ihnen sehr unterschiedliche Wertvor-
stellungen über den Wald und den Umgang mit ihm zu
finden sind. Vielfach sind Wohnort oder Lebensstil der
Eigentümer ausschließlich urban geprägt. Als „urban“
identifizierte Waldbesitzer sind längst im ländlichen Raum
präsent. Wurde der landwirtschaftliche Betrieb gemein-
sam mit dem Wald früher fast ausschließlich an männ-
liche Nachfolger vererbt, so hat sich dieses Bild drastisch
verändert. Betrachtet man das Geschlecht der Waldeigen-
tümer (Einzeleigentum, Miteigentum), so stehen heute
über 40 Prozent Frauen im Grundbuch. Studien über
„Waldbesitzerinnen“ zeigen, dass fur Frauen im Vergleich
zu ihren mannlichen Kollegen der materielle Gewinn aus
Waldeigentum eine eher untergeordnete Rolle spielt, ent-
sprechend wurden hier geringere Holzmengennutzungen
nachgewiesen.
12
Gleichzeitig interessieren sich Waldbesit-
zerinnen „starker fur okologische Themen und Ästhetik
im Wald als mannliche Waldbesitzer. Ihren Wald nutzen
sie zum Spazierengehen und Erholen viel häufiger als
Männer.“
13
Aus der sozialen Perspektive zeigt sich somit,
dass eine Integration dieser „neuen“ Waldbesitzer in etab-
lierte Forstwirtschafts- und Waldbesitzerorganisationen zu
deutlichen Veränderung in den Einstellungen und Wert-
haltungen dieser Organisationen führen wird.
12 Vgl. Jens Borchers: Geschlechterdifferenzierte Auswertung des Gutach-
tens „Strukturen und Motive des Waldbesitzes in NRW“. Vortrag/Prä-
sentation Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, o.O. 2004.
13 Tina Melder: Waldbesitzerinnen in Bayern. Geschlechterdifferenzierte Se-
kundäranalyse einer Waldbesitzerberfragung, Freising 2010.


















