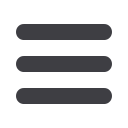

65
Politikfeld Wald
Einsichten und Perspektiven 4 | 16
Die Veränderung des Waldkleides
Von Natur aus wären in Bayern zwei Drittel der Waldflä-
che mit Laub-, ein Drittel mit Nadelbäumen bestockt. Auf
die Baumartenzusammensetzung hat der Mensch bereits
sehr früh Einfluss genommen. In Wäldern, in denen über-
wiegend Landwirtschaft in Form von Weide betrieben
wird, spielte z.B. die Eiche als Früchte tragende Baumart
eine zentrale Rolle in der Schweinemast. Dies führte zu
einem deutlichen Rückgang der Buche und einer Tradi-
tion der Eichenwirtschaft. In Niederwäldern wurden und
werden in einem bestimmen Turnus alle Bäume genutzt
(auf den Stock gesetzt
7
). Mit dieser Wirtschaftsweise wur-
den Baumarten protegiert, die die Fähigkeit besitzen, aus
dem Stock auszuschlagen.
Infolge der Devastierung (Zerstörung) der Wälder im
18. Jahrhundert wurde eine moderne wissenschaftsba-
sierte Forstwirtschaft, die ihren strukturellen Niederschlag
in Forstverwaltungen fand, eingeführt. Große, devastierte
Kahlflächen können aktiv am besten mit frost- und tro-
ckenresistenten Schlussbaumarten wie Kiefern und Fich-
ten begründet werden. Der Umbau der einst laubholz-
dominierten Wälder in nadelholzreiche Bestände (Kiefer,
Fichte) fand mit der wissenschaftlich begründeten Reiner-
7 Bäume verfügen über die Möglichkeit, aus dem Stock (Baumstumpf) neue
Triebe zu bilden. Diese Fähigkeit ist bei den Baumarten sehr unterschied-
lich ausgeprägt.
tragslehre seinen Höhepunkt. Nadelreinbestände prägen
heute noch das Waldbild. Neben der Etablierung einer
planmäßigen Holznutzung wurde zu dieser Zeit die Ent-
flechtung von der landwirtschaftlichen Nutzung in den
Wäldern als besondere Herausforderung gesehen. Die
Streunutzung
8
in den Wäldern spielt heute praktisch keine
Rolle mehr, die Weide findet noch auf wenigen Flächen
im Bayerischen Alpenraum und im Bayerischen Wald
traditionsgemäß statt. Die land- und forstwirtschaftliche
Nutzung wurde somit auf den meisten Flächen segregiert.
Aus der Perspektive des Artenschutzes sind jedoch die
Streunutzung und die damit verbundene Verarmung des
Bodens oder durch Weide licht gehaltene Wälder durch-
aus interessant und erhaltenswert. Die Arten haben sich
an dieses Nutzungsregime angepasst, so dass eine natürli-
che Entwicklung den „Lebensraum“ zerstört. Der Kampf
um die letzten Flechtenkiefernwälder, die bis jetzt über
90 Prozent ihrer Ausdehnung in Bayern verloren, veran-
schaulicht die Folgen dieser Entwicklung.
Vor allem großflächige abiotische und biotische Scha-
densereignisse (Insektenkalamitäten, Windwürfe, etc.)
haben bei zahlreichen politischen Akteuren eine kritische
Sicht auf die weit verbreiteten Nadelholzreinbestände
8 Wenn in Wäldern die Laub- oder Nadelstreu entfernt wird, so bezeichnet
man dies als Streunutzung. Die Streu wurde meist als Einstreu in der Vieh-
haltung verwendet.
Waldfläche in Bayern nach Baumartengruppe
Daten: Dritte Bundeswaldinventur 2012,
https://bwi.info/inhalt1.3.aspx?Text=1.04%20Baumartengruppe%20(rechnerischer%20Reinbestand)&prrolle=public&
prInv=BWI2012&prKapitel=1.04 [Stand: 29.11.2016]
14 %
15 %
41 %
1 %
17 %
2 % 2 % 0,2 %
2 %
7 %
Eiche 165.244 ha
Buche 338.317 ha
andere Laubbäume 365.679 ha
Fichte 1.017.672 ha
Tanne 57.193 ha
Kiefer 417.263 ha
Lärche 52.393 ha
Lücke 52.157 ha
Blöße 3.796 ha
Wasserfläche 1.234 km
Douglasie 19.196 ha


















