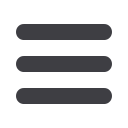
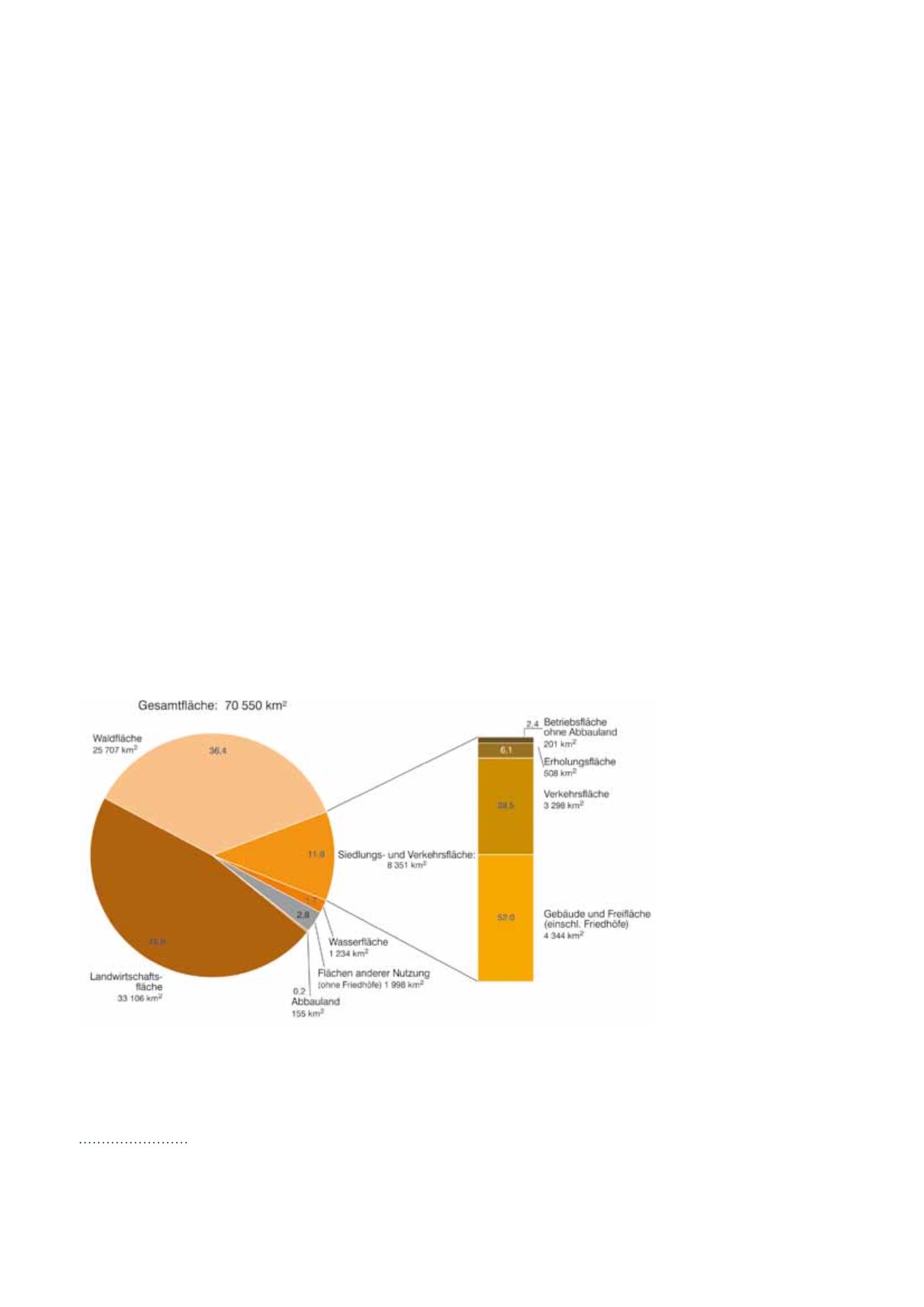
62
Politikfeld Wald
Einsichten und Perspektiven 4 | 16
Bodenfläche Bayerns zum 31. Dezember 2014 nach Nutzungsarten
Ergebnisse der Flächenerhebung – Anteile in Prozent
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, München, 2015,
https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet/#[Stand: 29.11.2016]
telpunkt. Den Abschluss bildet eine Analyse des gegenwär-
tig vorherrschenden Diskurses über Holznutzung oder Flä-
chenstilllegung und die konzeptuelle Strahlkraft, die mit
den Begriffen Segregation und Integration aufgebaut wird.
Das grüne „Drittel“ – Walderhaltung
Die Waldverteilung in Deutschland ist in den Ländern
sehr unterschiedlich ausgeprägt.
Insgesamt ist knapp ein Drittel der Fläche der Bundes-
republik Deutschland bewaldet, nämlich 32 Prozent. Dies
entspricht 11,4 Millionen Hektar (ha). Die Bandbreite
unter den Ländern reicht von einem Bewaldungsprozent
von 42 Prozent in Rheinland-Pfalz bis zu elf Prozent in
Schleswig-Holstein. Besonders hohe Bewaldungsprozente
weisen die Mittelgebirge auf.
4
Ein Drittel (ca. 2,6 Millionen ha) der Fläche in Bayern
ist Wald. Er bildet, folgt man einer zentralen Metapher,
„die grüne Lunge“ Bayerns und ist vielfach Bestandteil im
Begriff der „Bayerischen Heimat“. Bereits diese Metapher
und der Rang, den der Wald in Heimatvorstellungen ein-
nimmt, verdeutlichen, unabhängig von ihrem Wahrheits-
4 Vgl. Bundesministerium fur Ernährung und Landwirtschaft (BMEL): Der
Wald in Deutschland. Ausgewählte Ergebnisse der dritten Bundeswald
inventur,
2
Berlin 2016.
gehalt, eine besondere Wertschätzung für die mit Wald-
bäumen bestockten Flächen.
Schätzungen gehen davon aus, dass ohne menschlichen
Einfluss 70 Prozent der Landesfläche mit Wald bestockt
wären. Zu Beginn der menschlichen Besiedelung unserer
Landschaftsräume war Wald im Überfluss vorhanden –
und allgegenwärtiges Kulturhindernis. Seit dem Mittelal-
ter wurde dieser Anteil in mehreren Rodungswellen auf
30 Prozent reduziert. Durch das stetige Bevölkerungs-
wachstum ab der Neuzeit stieg der Nutzungsdruck auf
die Wälder örtlich stark an und führte zu einer enormen
Rohstoffknappheit. Vor allem die aufkommenden ener-
gieintensiven und damit in dieser Zeitepoche holzver-
brauchenden Gewerbe (Glashütten, Bergbau, Salinen)
standen dabei häufig in Konkurrenz zu den Ansprüchen
der lokalen Bevölkerung. Weite Teile der Wälder wurden
zudem intensiv landwirtschaftlich genutzt (Vieheintrieb,
Streunutzung). Durch erste Wald- und Forstordnungen
sollte die Nutzung der Wälder geregelt werden. Sie mar-
kieren den Übergang von Überfluss zu Knappheit in der
Auseinandersetzung mit Wald.


















