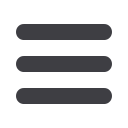

57
„Der Mensch hat kein Bewusstsein im Kampf ums Überleben. Er reagiert.“
Einsichten und Perspektiven 4 | 16
Auf einer zweitägigen Kooperationstagung der Landeszentrale und der Evan-
gelischen Akademie in Tutzing mit dem Thema „Gewalt – Entgrenzungen
und Einhegungen“ im November 2016
1
sprach Psychotherapeutin Barbara
Abdallah-Steinkopff (Refugio München) darüber, wie Frauen, die insbesondere
in Bürgerkriegssituationen mit extremer Gewalt konfrontiert waren, wieder ins
Leben zurückfinden können. Im Interview erzählt sie mehr über ihre Arbeit.
LZ:
Bitte erklären Sie uns Ihre Arbeit bei Refugio München.
Barbara Abdallah-Steinkopff:
Refugio wurde 1994 ge-
gründet und bietet muttersprachliche Beratung, Beglei-
tung und Behandlung für traumatisierte Flüchtlinge. Zu-
erst arbeiteten sechs Festangestellte mit – heute sind wir
43! Ich selbst bin seit Beginn hier beschäftigt und finde es
sehr spannend, die beiden Bereiche Klinik-Therapie sowie
das politisch-historische wie interkulturelle Arbeiten kom-
binieren zu können.
LZ:
Welchen besonderen Herausforderungen müssen sich
Psychotherapeuten in ihrer Arbeit im Kontext von Integ-
ration stellen?
Barbara Abdallah-Steinkopff:
Die Arbeit beruht auf In-
terkulturalität. Wir betreuen Menschen aus 50 Nationen.
Selbstverständlich sind uns viele Unterschiede zwischen
Ländern und Menschen bewusst. Doch ist es schlichtweg
unmöglich, über alle kulturellen Gegebenheiten oder Tra-
ditionen der Ursprungsländer der Patienten Bescheid zu
wissen. Wir gehen von einem professionellen Umgang mit
dem Nicht-Wissen aus. Um unsere Arbeit leisten zu kön-
nen, benötigen wir Dolmetscher, die auch als Kulturmitt-
ler zu verstehen sind. Oftmals bauen die Patienten selbst
eine Brücke und vermitteln, wenn man sie zu ihren kultu-
rellen Hintergründen fragt. Sie wissen ja am besten über
ihre eigene Kultur Bescheid. Entscheidend ist für uns, dass
wir aufgrund der unterschiedlichen Verhaltensweisen der
Patienten ihre jeweilige Symptomatik zu verstehen. Nur
so können wir ihnen helfen.
LZ:
Mit welchen Menschen haben Sie zu tun? Wo kommen
diese her? Um welche Themen geht es dabei?
Barbara Abdallah-Steinkopff:
Die Menschen haben Trau-
mata. Meist haben sie entweder in ihrem Herkunftsland
1 Tagungsbericht vgl.
http://www.ev-akademie-tutzing.de/aktuelles-presse/tutzinger-thesen/.
oder auf der Flucht Schlimmes erlebt. In vielen Fällen
trifft auch beides zu. Eine jede Flucht ist mit Gefahren
und Entbehrungen verbunden. Man kann fast sagen, sie
ist mit traumatischen Erlebnissen gepflastert. Der Weg aus
Eritrea zum Beispiel führt zum Beispiel durch die Saha-
ra und über das Mittelmeer. Speziell Frauen, aber auch
Männer, sind sexuellem Missbrauch ausgesetzt. Manch-
mal werden Mädchen zum Schutz früh verheiratet, um
dem Missbrauch entgegen zu wirken. Zudem kommen
sie ohne Schlepper nicht ans Ziel. Viele Betroffene waren
erst Binnenflüchtlinge und sind dann in ein Nachbarland
geflohen. Wenn auch dort die Versorgung zu schlecht ist,
sehen viele nur eine einzige Chance: ihre Heimat endgül-
tig zu verlassen und ins weitentfernte Europa zu gehen.
LZ:
Wie kann man mit Traumatisierungen solcher Art bei
Geflüchteten umgehen?
Barbara Abdallah-Steinkopff:
Wir sprechen von einem
Drei-Säulen-Modell: dem Trauma selbst (erfahren im
Herkunftsland und auf der Flucht) und den Folgestörun-
gen, dem Migrationsprozess mit seinen Auswirkungen,
i.S. von Postmigrationsstressoren, und dem Leben unter
für sie schwierigen (Exil-)Bedingungen. Diese drei Punk-
te spielen meist zusammen und machen eine Behandlung
notwendig. Da die Bedürfnisse und Probleme der – meist
unfreiwilligen – Migranten sehr komplex sind, arbeiten
wir interdisziplinär. Wir kooperieren mit Sozialpädago-
gen, aber auch mit Rechtsanwälten und Ärzten. Meist
sind es Betreuer aus den Unterkünften, die mit uns Kon-
takt aufnehmen. Teilweise werden Patienten auch von
psychiatrischen Einrichtungen überwiesen oder kommen
über die Bezirkssozialarbeit zu uns.
Die Menschen, die sich auf den Weg machen und ihre
Heimat zurück lassen, verfügen über viele Ressourcen.
Die meisten verfallen nach der Ankunft in Deutschland
erst einmal in ein Loch. Sie sind völlig erschöpft und füh-
len sich schwach. Ihnen ist oft gar nicht mehr bewusst,
wie sie die Flucht überhaupt bewerkstelligen konnten.


















