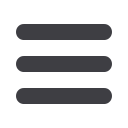

54
„Lebenswelten junger Muslime in Deutschland“ – reloaded
Einsichten und Perspektiven 4 | 16
Abbildung 3: Zusammenfassende und vereinfachte Darstellung der Befunde
Quelle: Frindte/Ben Slama/Dietrich/Pisoiu/Uhlmann/Melanie Kausch (wie Anm. 12), S. 16
Aber so einfach ist die wirkliche Wirklichkeit eben doch
nicht.
Im Jahre 2010 veröffentlichte der US-amerikanische
Anthropologe Scott Atran ein Buch mit dem Titel
„Tal-
king to the enemy“.
17
In diesem Buch geht es darum, was
Menschen bewegt, sich dem Dschihad anzuschließen.
Atran hat u.a. viel Zeit mit Mujahedin-Gruppen weltweit
verbracht und viele Interviews geführt. Eine wesentliche
Erkenntnis aus diesen Interviews lässt sich wohl so zusam-
menfassen: Nicht die Religion an sich sei die Ursache für
Krieg und Gewalt. Tatsächlich seien die wenigsten Frei-
willigen, die sich dem IS anschließen, besonders religiös
gebildet. Doch vielmehr spiele für diejenigen, die sich
völlig dem Dschihad verschreiben, die ausschließliche
Identifikation mit der Gemeinschaft der Kämpfer die ent-
scheidende Rolle.
Man könnte auch sagen: Je zentraler und ausschließli-
cher die Identifikation mit der muslimischen Gemeinschaft
(umma),
also die soziale Identität als Muslim, ist, umso eher
werden die von der muslimischen Gemeinschaft vertrete-
nen Vorstellungen als einzigartig, alleingültig und funda-
17 Scott Atran: Talking to the enemy: Violent extremism, sacred values, and
what it means to be human, London 2010.
mental für die Gestaltung von Gesellschaft angesehen und
u.U. mit Gewalt verteidigt. Unter sozialer Identität wird die
Summe der Identifikationen mit bestimmten sozialen Kate-
gorien (Gruppen, Gemeinschaften, Milieus oder sozialen
Bewegungen) und die mit diesen Kategorien assoziierten
Werte und Vorstellungen verstanden. Um diese Zentrali-
tät und Ausschließlichkeit der sozialen Identität als Muslim
oder Muslima begrifflich zu beschreiben, wird in der Sozial
psychologie von der Omnipräsenz der sozialen Identität
gesprochen. Omnipräsent ist eine soziale Identität dann,
wenn sie nahezu ausschließlich über die Identifikation mit
einer sozialen Kategorie (hier mit den Muslimen und der
umma)
erfolgt und die Identifikation mit anderen sozialen
Kategorien (z.B. mit einer Nation oder einer Berufsgruppe)
als gar nicht wichtig angesehen wird. Das heißt, alles wird
der Zugehörigkeit und der Identifikation mit der Gemein-
schaft der Muslime untergeordnet. Alles andere zählt nicht.
Dies kann so interpretiert werden, dass die soziale Identität
als Muslim als entscheidender Schlüssel die Beziehung zwi-
schen den möglichen Bedingungen und den islamistisch-
fundamentalistischen Überzeugungen vermittelt.
Gruppenbezogene
Diskriminierung
Negative Emotionen
gegenüber „dem Westen“
Vorurteile gegenüber
„dem Westen“
Vorurtile gegenüber
„den Deutschen“
Akzeptanz
ideologisch fundierter
Gruppengewalt
Islamistisch-
fundamentalistische
Überzeugungen
Dominante und aus-
schließliche Identifikation
mit der Gemeinschaft
der Muslime
Respekt vor familiären
Sitten und Gebräuchen
Religiösität
Autoritäre
Überzeugungen


















