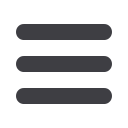

50
„Lebenswelten junger Muslime in Deutschland“ – reloaded
Einsichten und Perspektiven 4 | 16
•
In Fokusgruppen (d.h. Diskussionsrunden) mit Gruppen
junger Muslime aus verschiedenen Regionen Deutsch-
lands wurden die Ergebnisse der Panel-Befragung und
der Medienauswertung schließlich im Zusammenhang
und mit den „Betroffenen“ gemeinsam diskutiert. In
diesen Fokusgruppen wurden sowohl Fragen der eigenen
Religiosität, Identität und der Erfahrung, als Muslim in
Deutschland zu leben, als auch Fragen zu politischen
und gesellschaftlichen Themen thematisiert und quali-
tativ ausgewertet.
„So durcheinander zwischen den Welten“: Synopsis
In der Mehrgenerationsfallstudie wurden sechs muslimi-
sche Familien mit jeweils drei Generationen interviewt.
Die erste Generation war im Schnitt 64,7 Jahre, die zweite
Generation durchschnittlich 46,0 und die dritte Genera-
tion 16,8 Jahre alt. Unter den 18 teilnehmenden Personen
waren 12 Frauen. In fast allen Interviews mit den verschie-
denen Generationsmitgliedern zeigte sich einerseits, dass
sich die Interviewten – unabhängig vom Grad ihrer Reli-
giosität und der Integration in die deutsche Gesellschaft –
deutlich vom islamistischen Terrorismus distanzierten.
9
Mit anderen Worten: Islamistischer Terrorismus sei
mit dem Islam nicht vereinbar und schade nur seinem
Ansehen. Andererseits nahmen sie „den Westen“ wegen
seines Umgangs mit der islamischen Welt und den
islamistischen Terrorbedrohungen überwiegend nega-
tiv wahr. Überhaupt wurde die westliche Welt
in ihrer
Beziehung zur islamischen Welt von allen Teilnehmern
durchgehend negativ beurteilt. „Der Westen“ habe kein
wirkliches Interesse an einer Lösung der Konflikte, die
mit islamischen Ländern bestünden, sondern sei daran
interessiert, die eigenen Machtansprüche und wirtschaft-
lichen Interessen durchzusetzen. Unter diesem Aspekt
wurde vor allem das Verhalten der westlichen Truppen in
den Ländern Afghanistan und Irak (v.a. die Gewalt gegen
Zivilisten) besonders stark kritisiert. Auch die deutsche
nichtmuslimische Bevölkerung wurde von den Interview-
ten als distanziert und abweisend beschrieben. Der Islam
und die damit verbundene Lebensweise würden von der
Mehrheitsbevölkerung in Deutschland nicht genügend
akzeptiert.
9 Beispiel für eine solche Aussage (Befragter aus zweiter Generation):
„Die
Person, die ihr Land verteidigt, ist es fair sie Terrorist zu nennen, und den
Dieb, der gekommen ist um das Land zu besetzen, einen Selbstverteidiger
zu nennen? Das ist, was ich meine. Aber die Leute, die um die Welt reisen
und den Tod Unschuldiger in Zügen verursachen, das sind kriminelle Mör-
der, die haben keine Prinzipien.“
Zitat aus einem Interview mit einem jungen Mann aus der
dritten Generation: „Man geht raus, und wenn ich raus-
gehe, sehe, wie jemand trinkt, und jemand macht das und
das, was in meiner Religion verboten ist, und ich sehe das
und manchmal ist man so deprimiert, man ist so fertig, dass
man als Einziger das nicht darf und alle anderen machen
das. Du bist so durcheinander zwischen den Welten.“
Das spiegle sich auch in den (deutschen) Medien wider.
Vor allem die häufig undifferenzierte und übertriebene
mediale Darstellung „der“ Muslime und die in den Medi-
enberichten zu beobachtende generelle Verknüpfung von
Muslimen mit dem Terrorismus schade dem Ansehen der
in Deutschland lebenden Muslime. Deutlich wurde in
den Interviews aber auch der Wunsch, neben einer Integ-
ration in die deutsche Gesellschaft eine muslimische Iden-
tität leben und gestalten zu dürfen.
10
Dass es „die eine Art“ von Muslimen
in Deutschland
nicht gibt, wurde auch in der zweiwelligen telefonischen
Panelbefragung deutlich. Ein großer Teil der befragten deut-
schen und nichtdeutschen Muslime wünschte sich, ihre tra-
ditionelle Herkunftskultur zu bewahren und gleichzeitig die
deutsche Mehrheitskultur zu übernehmen. Einstellungen zur
Integration (im sozialpsychologischen Sinne) waren nach der
Studie bei den Muslimen mit deutscher Staatsangehörigkeit
im Vergleich zu den nichtdeutschen Muslimen am stärksten
ausgeprägt. Die befragten Muslime äußerten im Durch-
schnitt (im Vergleich zu den befragten deutschen Nicht-
muslimen) stärkere Vorurteile gegenüber dem Westen und
gegenüber Juden, stärker ausgeprägte religiös-fundamenta-
listische Einstellungen, stark negative Emotionen gegenüber
demWesten, eine größere Distanz zur Demokratie und eine
höhere Akzeptanz ideologisch fundierter „Gewalt als Mittel
zur Verteidigung gegen die Bedrohung durch den Westen“.
Abbildung 2 illustriert die besagten Unterschiede. Sie
lässt sich folgendermaßen lesen: Während z.B. 17,8 Pro-
zent der deutschen Nichtmuslime ausgeprägte Vorurteile
gegenüber dem „Westen“ äußern, tun dies 45,2 Prozent
der deutschen Muslime (also der Muslime mit deutscher
Staatsangehörigkeit) und 47,1 Prozent der Muslime ohne
deutsche Staatsangehörigkeit (nichtdeutsche Muslime).
10 Interviewbeispiel (ebenfalls von einem Mitglied der dritten Generation):
„Deutschland sagt immer so eh also integrieren sollen sie, äh, also sollen
sie sich und so äh sagen sie, ähm aber also es stimmt, manchmal haben
sie recht, die meisten Menschen integrieren sich wirklich nicht so sehr, äh
sie haben nichts mit den Deutschen zu tun, und sie können kaum Deutsch
sprechen und so, ich verstehe sie sehr gut, aber ich zum Beispiel … also …
ähm um zum Beispiel genau wie sie zu sein, um sich zu assimilieren, muss
man so leben wie sie und also indem ich meine Religion lebe, kann ich
nicht so wie sie äh leben. Es gibt da einen Unterschied zum Beispiel und
ich ähm kann das nicht verändern.“


















