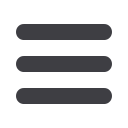

49
„Lebenswelten junger Muslime in Deutschland“ – reloaded
Einsichten und Perspektiven 4 | 16
und Akzeptanz von und Bereitschaft zu ideologisch fun-
dierter Gruppengewalt.
Unter religiösem Fundamentalismus wird eine strenge
Form der Religiosität verstanden, a) in der die Religion
nicht nur als Grundlage des eigenen Lebens, sondern auch
der gesellschaftlichen Grundordnung begriffen und b) die
Welt in dualistischer Weise in „gut“ und „böse“ eingeteilt
wird, c) in der Gebote und Verbote durch den Verweis auf
die göttliche Autorität begründet werden, als unantastbar
gelten und die religiösen Lehren und die zugrunde liegen-
den Texte wortwörtlich zu befolgen sind, d) die allerdings
nur bestimmte Elemente des Glaubens als heilig erachtet,
andere ignoriert oder umgedeutet werden und e) in der
die Vorstellung vom bald bevorstehenden Ende der Welt
bzw. eine starke Fokussierung auf das „Jenseits“ dominiert.
Der vierte Variablenblock widmet sich der Analyse
zielgruppenorientierter Fernsehberichterstattung und der
Nutzung von Internetforen und Blogs.
Die Analyse des nationalen und internationalen For-
schungsstandes führte außerdem zu weiteren methodischen
und forschungspraktischen Entscheidungen und Folgerun-
gen:
•
Die Studie konzentrierte sich auf die Untersuchung der
Einstellungenvon14-bis32-jährigenmuslimischenImmi-
granten aus arabisch und türkischsprachigen Ländern und
auf muslimische Deutsche (also Muslime mit deutscher
Staatsangehörigkeit) dieser Altersgruppe. Um deren Ein-
stellungen abschätzen und beurteilen zu können, wurden
auch Vergleiche mit nicht-muslimischen Deutschen (als
Kontrollgruppe) der Altersgruppe der 14- bis 32-Jähri-
gen durchgeführt. Die Auswahl dieser Altersgruppe hängt
nicht nur mit forschungspraktischenGründen zusammen,
sondern folgt auch der Einsicht, dass gerade junge Mus-
lime dieser Altersgruppe die größten Probleme haben, in
Deutschland die gleichen Bildungschancen und Arbeits-
möglichkeiten wahrzunehmen wie ihre nicht-muslimi-
schen Altersgenossen. Die Mitglieder dieser Altersgruppe
gehören zumeist zur sogenannten „drittenGeneration“ der
muslimischenMigranten, die vor anderenAkkulturations-
anforderungen stehen als ihre Eltern und Großeltern.
8
Letztlich wurden also drei Gruppen miteinander vergli-
chen: a) nichtdeutsche Muslime, b) deutsche Muslime
und c) deutsche Nicht-Muslime.
8 Vgl. auch Karin Brettfeld/Peter Wetzels : Muslime in Deutschland. Integ-
ration, Integrationsbarrieren, Religion sowie Einstellungen zu Demokratie,
Rechtsstaat und politisch motivierter Gewalt, hg. v. d. Universität Ham-
burg/BMI, Hamburg 2007. Sonja Haug/Stephanie Müssig/Anja Stichs:
Muslimisches Leben in Deutschland, hg. v. Deutsche Islam Konferenz/
BAMF, Nürnberg 2009.
•
Die Entwicklung von Vorurteilen im Allgemeinen
und Integrations- und/oder Radikalisierungsprozesse
im Besonderen können langfristigen Entwicklungs-
pfaden folgen, aber auch ereignisbezogen (z.B. Stich-
wort: Flüchtlingsprobleme) offenkundig werden. Um
derartige Prozesse abbilden und erfassen zu können,
wurden die geplanten Vergleiche zwischen der Kont-
rollgruppe und den Zielgruppen im Zeitverlauf als fra-
gebogengestützte, telefonische Panel-Erhebung zu zwei
Messzeitpunkten
durchgeführt (Gesamtstichprobe –
erste Erhebungswelle: N= 923; davon in der zweiten
Erhebungswelle: N= 450). Die erste Erhebungswelle
fand von Oktober bis Dezember 2009, die zweite Erhe-
bungswelle von August bis Oktober 2010 statt.
•
Außerdem war dem Forschungsteam wichtig, die
quantitativen Befunde mit den Meinungen und Ein-
stellungen höherer Altersgruppen zu vergleichen. Da
davon ausgegangen werden kann, dass z.B. von älteren
Familienmitgliedern, Freunden oder Glaubensgenos-
sen starke Sozialisationswirkungen ausgehen können,
wurde eine qualitative Mehrgenerationenfallstudie
durchgeführt. Dabei handelte es sich um Interviews
mit einer Dauer zwischen 31 Minuten und 4,5 Stun-
den, die aufgezeichnet, transkribiert und (falls nicht
in Deutsch geführt) durch Muttersprachler übersetzt
wurden.
•
Dass mediale Konstruktionen über das „Eigene“ und
das „Fremde“, über „den Westen“ und „den Islam“ die
Vorurteile zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen
im Allgemeinen und die Akkulturations- und Integra-
tionsprozesse im Besonderen beeinflussen können, ist
mittlerweile empirisch gut belegt. Aus diesem Grunde
wurde die Berichterstattung über das Verhältnis von
Muslimen und Nicht-Muslimen in deutschen (ARD
Tagesschau, ZDF heute, RTL aktuell, Sat.1 Nachrich-
ten), türkischen (TRT Türk, Kanal D) und arabischen
(Al Jazeera, Al Arabiya) Fernsehsendern medienwissen-
schaftlich ausgewertet. Dazu wurden insgesamt 4.160
Nachrichtensendungen mit einer Spielzeit von ca.
16.917 Stunden aufgezeichnet und 629 Beiträge gezielt
analysiert.
•
Neben den Effekten der „traditionellen“ Verbreitungs-
medien (insbesondere des Fernsehens) fungiert mitt-
lerweile das Internet als wichtiges, in jüngeren Alters-
gruppen sogar dominantes Medium. Um den Einfluss
der Internetkommunikation zu analysieren, wurden
neun relevante, hauptsächlich von jungen Muslimen
genutzte Internetforen einer inhaltsanalytischen Aus-
wertung unterzogen.


















