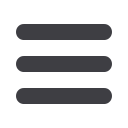

52
„Lebenswelten junger Muslime in Deutschland“ – reloaded
Einsichten und Perspektiven 4 | 16
sen vermögen, wurde in einem letzten Forschungsschritt
die Darstellung von Muslimen und Nichtmuslimen in der
deutschen, türkischen und arabischen Berichterstattung
ausgewählter Fernsehsender zwischen Anfang 2009 und
Ende 2010 untersucht. Die Auswertung dieser Fernsehnach-
richten machte deutlich, dass und wie Integrations- und
Radikalisierungsprozesse durch mediale Einflüsse gefördert
oder verhindert werden können. In den untersuchten Bei-
trägen sticht insbesondere der türkische Privatsender Kanal
D durch eine sehr emotional geprägte Berichterstattung
hervor. Dies würde teilweise erklären, warum vor allem die
Präferenzen für türkische Sender (vor allem Kanal D/Euro
D) einen starken Einfluss auf die Akzeptanz ideologisch
fundierter Gruppengewalt der nichtdeutschen Muslime
auszuüben scheinen. Die deutschen öffentlich-rechtlichen
Fernsehsender spielen im Kontext der Integrationsdebatten
mithin eine durchaus positive Rolle. Die Familieninter-
views und Gruppendiskussionen zeigten allerdings, dass das
öffentlich-rechtliche Fernsehen die muslimische Bevölke-
rung Deutschlands kaum erreicht.
Die Ergebnisse der Studie bestätigen insgesamt, dass es
nach wie vor notwendig ist, gesellschaftliche Initiativen und
Maßnahmen zu realisieren, die den Aufbau einer positiven
bikulturellen Identität der Muslime erleichtern. Auf diese
Weise würde islamistischen Radikalisierungsprozessen vor-
gebeugt und Integrationsprozesse könnten befördert wer-
den. Und den Muslimen ginge es nicht mehr so, wie o.g. im
Interview: „Man ist so durcheinander zwischen den Wel-
ten“. Muslimische Zuwanderer in Deutschland sollen und
wollen die deutsche Lebenswelt mit ihren Gesetzen, For-
men des Zusammenlebens, ihrer Sprache sowie ihren Nor-
men des alltäglichen mitmenschlichen Umgangs anneh-
men. Allerdings muss ihnen auch die Freiheit zugestanden
werden, die deutsche Lebenswelt mit der Lebenswelt ihrer
Herkunftskultur zu verknüpfen. Letztendlich ist diese Inte-
gration ein wechselseitiger Prozess, der nur bei gemeinsa-
mem Engagement sowohl der Migranten als auch der deut-
schen Mehrheitsbevölkerung gelingen kann.
„Lebenswelten-Projekt“ – updated: Was fördert
islamistisch-fundamentalistische Überzeugungen
und Gewaltbereitschaft?
In einer im Sommer 2016 veröffentlichten repräsentativen
Umfrage,
11
an der rund 2.400 Bürgerinnen und Bürger teil-
nahmen, äußerten 73 Prozent der Befragten große Angst vor
11 R+V-Studie: Die Ängste der Deutschen 2016, in:
https://www.ruv.de/presse/aengste-der-deutschen [Stand 17.09.2016].
Terrorismus. Die gefühlte Terrorbedrohung entspricht nicht
der tatsächlichen Bedrohungslage; dennoch ist Deutsch-
land Teil des dschihadistischen Netzwerks in Europa – als
logistische Drehscheibe und Rückzugsort. Nicht zuletzt die
Anschläge in Würzburg und Ansbach im Sommer 2016
haben das deutlich gemacht.
Spätestens seit 2008 ist Deutschland auch Herkunftsland
von Dschihadistinnen und Dschihadisten, die zunächst –
bis 2011 – in das afghanisch-pakistanische Grenzgebiet und
in jüngerer Zeit überwiegend in die Kriegsgebiete Syriens
oder Iraks ausreis(t)en.
12
Im aktuellen Bericht der Ständigen Konferenz der
Innenminister und -senatoren der Länder werden die
Fälle von 677 Personen, die aus Deutschland in Richtung
Syrien oder Irak ausgereist sein sollen, analysiert.
13
Davon
sollen bis zum 30. Juni 2015 insgesamt 237 Personen
nach Deutschland zurückgekehrt sein. Von den ausgereis-
ten Personen sind 21 Prozent Frauen. Mit 188 Personen
stellen die 22- bis 25-Jährigen die größte Altersgruppe.
14
Vor einigen Jahren kommentierte Peter Sloterdijk:
„… der sogenannte globale Terrorismus ist ein durch
und durch posthistorisches Phänomen. Seine Zeit bricht
an, wenn sich der Zorn der Ausgeschlossenen mit der
Infotainmentindustrie der Eingeschlossenen zu einem
Gewalttheatersystem für letzte Menschen verbindet“.
15
In
diesem Sinn ist der globale Terrorismus auf die Medien
angewiesen und bezieht sie in seine Strategie mit ein. Zu
einer Bekämpfung des Terrorismus stellt sich vorrangig
die Frage nach den apostrophierten „Ausgeschlossenen“
selbst: Wer sind sie, wovon sind sie ausgeschlossen, wer
hat sie ausgeschlossen und was ist die Quelle ihres Zorns?
Es reicht also nicht, nur nach individuellen Risiko-
merkmalen zu suchen und soziale Kontextfaktoren nur
am Rande zu berücksichtigen, wenn es um praktisch rele-
vante Erklärungen für die Radikalisierung salafistischer
Dschihadisten geht. Um konkret zu werden: Die Atten-
täter von Paris, Brüssel und Nizza sind in Frankreich oder
12 Wolfgang Frindte/Brahim Ben Slama/Nico Dietrich/Daniela Pisoiu/Milena
Uhlmann/Melanie Kausch: (2016). Wege in die Gewalt. Motivationen und
Karrieren salafistischer Dschihadisten. HSFK-Report, Nr. 1/2016 (HSFK-
Reportreihe „Salafismus in Deutschland“, hg. von Janusz Biene/Christo-
pher Daase/Svenja Gertheiss/Julian Junk/Harald Müller).
13 IMK (Ständige Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder):
Analyse der Radikalisierungshintergründe und -verläufe der Personen, die
aus islamistischer Motivation aus Deutschland in Richtung Syrien oder
Irak ausgereist sind.
14 Ebd., S. 11.
15 Peter Sloterdijk: Zorn und Zeit. Politisch-psychologischer Versuch, Frank-
furt am Main 2006, S. 70.


















