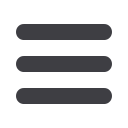

58
„Der Mensch hat kein Bewusstsein im Kampf ums Überleben. Er reagiert.“
Einsichten und Perspektiven 4 | 16
Erst im Gespräch kristallisiert sich nachträglich eine
Überlebensstrategie heraus. Im Überlebensmodus sind
Menschen zu Ungeahntem fähig. Erst nach dieser langen
Reise mit Angst, Not und Gewalt machen sich die Fol-
gen bemerkbar. Die Patienten leiden an Schlafstörungen,
Flash Backs (nachhaltigem Wiedererleben) oder Nervosi-
tät bzw. Übererregung – alles Kennzeichen einer Posttrauma-
tischen Belastungsstörung. Das Trauma ist wie ein Schat-
ten. Nicht selten versuchen die Betroffenen sich selbst zu
helfen. Sie beruhigen sich mit Alkohol oder Drogen. Die
Methode Therapie ist in vielen Ländern, aus denen die
Menschen kommen, nicht bekannt oder gar verpönt. Des-
halb suchen die Traumatisierten uns auch meist nicht auf
Eigeninitiative auf.
LZ:
Die Betroffenen kommen in eine Gesellschaft, von der
sie viel gehört haben und die ihnen als Schutzraum dient.
Gleichzeitig ist ihnen dieser neue Raum aber völlig fremd.
Welche Erfahrungen machen Sie damit?
Barbara Abdallah-Steinkopff:
Wichtig ist ein early ac-
cess. Je eher wir die Geschädigten erreichen, desto wirksa-
mer ist unsere Arbeit. Solch eine Behandlung dauert meist
nicht länger als sechs Monate. Wir wollen die Flüchtlin-
ge stabilisieren und zur Selbsthilfe anregen. Viele benö-
tigen aber eine Langzeitbetreuung mit unterschiedlichen
Frequenzen (mal sind mehr Therapiestunden notwendig,
mal weniger). Ihre Lebensbedingungen hier sind äußerst
schwierig – deshalb kommt es oft zu Krisen. Problema-
tisch sind auch Trigger (Auslöser), die sie an ihre Erlebnis-
se erinnern. Es kann sich hierbei – in hier ganz normalen
Alltagssituationen – zum Beispiel um Wasser oder Enge
handeln. In einem solchen Fall können die schlimmen
Bilder und Erinnerungen wieder hochkommen. Die meis-
ten der Patienten genießen kaum Privatsphäre oder haben
keinen sicheren Aufenthaltsstatus. Die Betroffenen leben
mit dem Gefühl, morgen das Land ggf. schon wieder ver-
lassen zu müssen. Ein Einleben ist unter solchen Umstän-
den manchmal kaum möglich.
LZ:
Wie nehmen die Geflüchteten diese Welt wahr?
Barbara Abdallah-Steinkopff:
Ein Problem stellen fal-
sche Erwartungen dar. Viele Migranten empfinden es so,
dass ‚Mitgebrachtes‘ (eine Ausbildung, ein Studium oder
ihr Knowhow) nichts wert ist. Es ist, als ob sie ihre Bio-
grafie an der Grenze abgegeben hätten. Sie müssen von
„Null“ starten. Dieses Gefühl darf nicht unterschätzt wer-
den. Viele Kompetenzen bleiben ungenutzt. „Akademiker
findet man am Taxistand“, wie es Annette Schavan einmal
ausgedrückt hat. Alles hängt vom Willen der Flüchtlinge
plus den Bedingungen im Ankunftsland bzw. vom Willen
der aufnehmenden Bevölkerung ab.
LZ:
Machen sich in diesem Kontext kulturelle Gräben be-
merkbar?
Barbara Abdallah-Steinkopff:
Ich finde es besser nicht
zwischen Kulturen oder Religionen zu unterscheiden,
sondern von verschiedenen Milieus zu sprechen. Es be-
stehen zum Beispiel große Diskrepanzen zwischen Stadt-
und Landbewohnern und ihren Gewohnheiten. Die Leu-
te aus Großstädten wie Aleppo, Damaskus, Kabul oder
Teheran und München handeln oft ähnlich, ebenso wie
die Bewohner der ländlichen Gebiete – selbst wenn sie aus
verschiedenen Ländern und Kontinenten stammen. Ich
möchte damit sagen, dass die Unterschiede zwischen den
Milieus häufig größer sind, als die zwischen den Kulturen.
LZ:
In unserer Gesellschaft gibt es viele Ängste über den
Umgang mit der 2015 neu entstandenen Situation. Was
würden Sie der politischen Bildung für Anregungen geben?
Barbara Abdallah-Steinkopff:
Wenn es um die Integra-
tion von Flüchtlingen in unsere Gesellschaft geht, stimme
ich Prof. Dr. Annette Treibel-Illian aus Karlsruhe zu. Sie
spricht von einem Leitbild für das Einwanderungsland
Deutschland und Integrationskursen für alle – also Deut-
sche wie Geflüchtete. Der Kontakt und Austausch zwi-
schen beiden Parteien muss gefördert werden, um Ängs-
ten zu begegnen. Die Bevölkerung muss mitgenommen
werden. Hier gibt es einige Initiativen, wie in München
SteG“. Sie setzt sich für Konfliktlösung ein und vermittelt
zum Beispiel im Rahmen einer Bürgerversammlung zwi-
schen Flüchtlingen und Anwohnern.
LZ:
Wie verknüpfen Sie die Arbeit der Traumabewältigung
mit dem interkulturellen Aspekt?
Barbara Abdallah-Steinkopff:
Wichtig sind uns bei Re-
fugio die muttersprachliche Behandlung und die Sensibi-
lität für die kulturellen Unterschiede (Kultursensibilität).
Wir bieten Elternseminare an, die sich mit der Kindeser-
ziehung beschäftigen. Hier arbeiten Männer und Frauen,
sogenannte Elterntrainer, aus den Herkunftsländern und
bieten Beratung in der Muttersprache der Flüchtlinge.
Diese Seminare sollen helfen, den Eltern Orientierung
im neuen Umfeld zu bieten. Unser Personal verfügt über
Kenntnisse der Situation im Herkunfts- und Ankunfts-
land. Dies trägt zum Erfolg unserer Projekte bei.
Wir legen viel Wert auf Vernetzung und in Einzelfällen
ist ein Austausch mit Kirchen oder Moscheen hilfreich, da
diese ein hervorragendes Wertesystem vermitteln. Diese


















