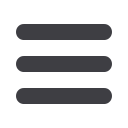

40
„Alle Terroristen sind Moslems“?
Einsichten und Perspektiven 4 | 16
Damit finden sich auch hier die oben genannten vier analy-
tischen Elemente wieder. Bei dem
Grande Terreur
handelte
es sich um eine politische Gewalt (1), die die Bürger durch
ein Regime aus Angst und Schrecken (3), vor dem grund-
sätzlich niemand geschützt war (4), zu einem bestimmten
Verhalten (hier: Tugendhaftigkeit) zwingen wollte (2).
Die Problematik im Umgang mit dem Begriff Terro-
rismus ist, dass er im historischen Prozess eine wider-
sprüchliche Wandlung erfahren hat, was die zum Teil
unterschiedlichen Begriffspaare und Begriffsbelegungen
erklärt. Aus dem
Grande Terreur
wurde im 19. Jahrhun-
dert eine Form politischer Gewalt, die sich nicht nur vom
Staat emanzipierte, sondern die sich jetzt auch dezidiert
gegen den Staat und die durch ihn vertretene Ordnungs-
vorstellung wenden sollte. Dies hat für die politikwissen-
schaftliche Betrachtung zur Folge, dass sich am Begriff
Terrorismus zwei unterschiedliche Akteure der politischen
Gewalt festmachen lassen: der Staat und der nicht-staatli-
che, private Akteur. Daher kann sowohl von Terrorismus
als auch von Staatsterror oder, vor allem im angelsächsi-
schen Sprachraum, von
state terrorism,
also Staatsterroris-
mus, die Rede sein. Darauf gehen auch alltagssprachliche
Verwendungen wie Telefon- oder Psychoterror zurück,
die sich von der politischen Zielsetzung gelöst haben und
für extreme Formen der Belästigung stehen.
Auch wenn es der Französischen Revolution vorbehal-
ten war, den Terrorismus als systematische Form brutaler,
willkürlicher politischer Gewalt im öffentlichen Bewusst-
sein zu verankern, so sind die Elemente des Terrorismus
selbst keine moderne Erfindung.
Die Verbreitung von Angst und Schrecken war über die
Jahrhunderte hinweg das erste Mittel der Wahl, um Herr-
schaft zu sichern. Für Thomas Hobbes war es die Angst
vor der Bestrafung
(„terror of legal punishment“
25
),
die im
Staat für die notwendige Beachtung der Gesetze sorgte
und damit dem Staat überhaupt erst Bestand verlieh. Diese
Angst vor der Bestrafung greift bereits auf ein weiteres Ele-
ment des Terrorismus vor, der Zerstörung von Sicherheit,
dem Gefühl des Ausgeliefertseins, der Machtlosigkeit. Der
dazu gehörige lateinische Ausdruck ist
territio
, was so viel
wie „Schreckung“ bedeutet und, beispielsweise im Mittel-
alter, das Zeigen der Folterinstrumente meinte. Die
territio
selbst war eine Vorstufe der Folter und sollte den Delin-
quenten durch das Aufzeigen dessen, was ihn erwarten
würde, zum Geständnis zwingen. Wesentlich für die Wir-
kung dieser Maßnahme war natürlich die Hilflosigkeit und
25 Thomas Hobbes: Leviathan 1651, Leicester 1969, S. 377.
Ohnmacht des Gefangenen. So konnte das Demonstrieren
der Instrumente, verbunden mit dem Wissen, dass man
dem Folterknecht ausgeliefert war, allein schon zum Terror
werden. Des Weiteren gehörte zum
terror of legal punish-
ment
auch die Öffentlichkeit der Bestrafung. Das gilt für
die Kreuzigungen im Römischen Imperium ebenso wie für
die Scheiterhaufen zur Zeit der Hexenprozesse oder für die
Hinrichtungen im vorrevolutionären Frankreich. Wenn
der IS/
Daesh
heute seine Hinrichtungen über
Youtube
ver-
breitet, dann ist das weder eine neue, noch eine spezielle
islamistische Praxis, sondern nur die moderne Fortsetzung
einer „gut erprobten“ abendländisch-christlichen Praxis.
Terror war, historisch gesehen, nicht nur ein Mittel
des Staates oder der Machthaber. Auch nicht-staatliche
oder private Gruppen und Akteure haben sich des Terrors
bedient, um ihre Ziele zu erreichen. In der Literatur wer-
den als historische Vorläufer des modernen Terrorismus –
und damit ist gemeinhin gemeint: der anti-staatlichen
Gewalt – häufig die jüdischen Zeloten und
Sicarii
, die
Assassinen und die Thugs genannt. Gemeinsam ist die-
sen Gruppen, dass sie tödliche Gewalt als legitimes Mittel
ansahen. Der Unterschied aber liegt in der mit der Gewalt
verbundenen Zielsetzung.
Während die Zeloten, ihre Splittergruppe, die
Sicarii,
und
Assassinen ein politisches Ziel verfolgten, sprich: eine Ver-
änderung der politischen Ordnung herbeiführen wollten,
töteten die indischen Thugs, Mitglieder einer religiösen
Sekte, die der blutrünstigen Göttin Kali geweiht war, um
des Töten willens. Das Töten verfolgte keinen politischen
Das Westtor der ehemaligen Festung Masada in Israel. Die Sicarii, die sich
gegen die Besatzung der Römer aufgelehnt hatten, flohen vor den Römi-
schen Truppen hierher und begingen Massenselbstmord.
Foto: ullstein bild/Heritage Images/Sites&Photos


















