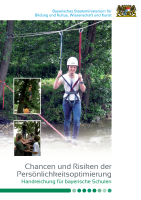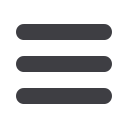
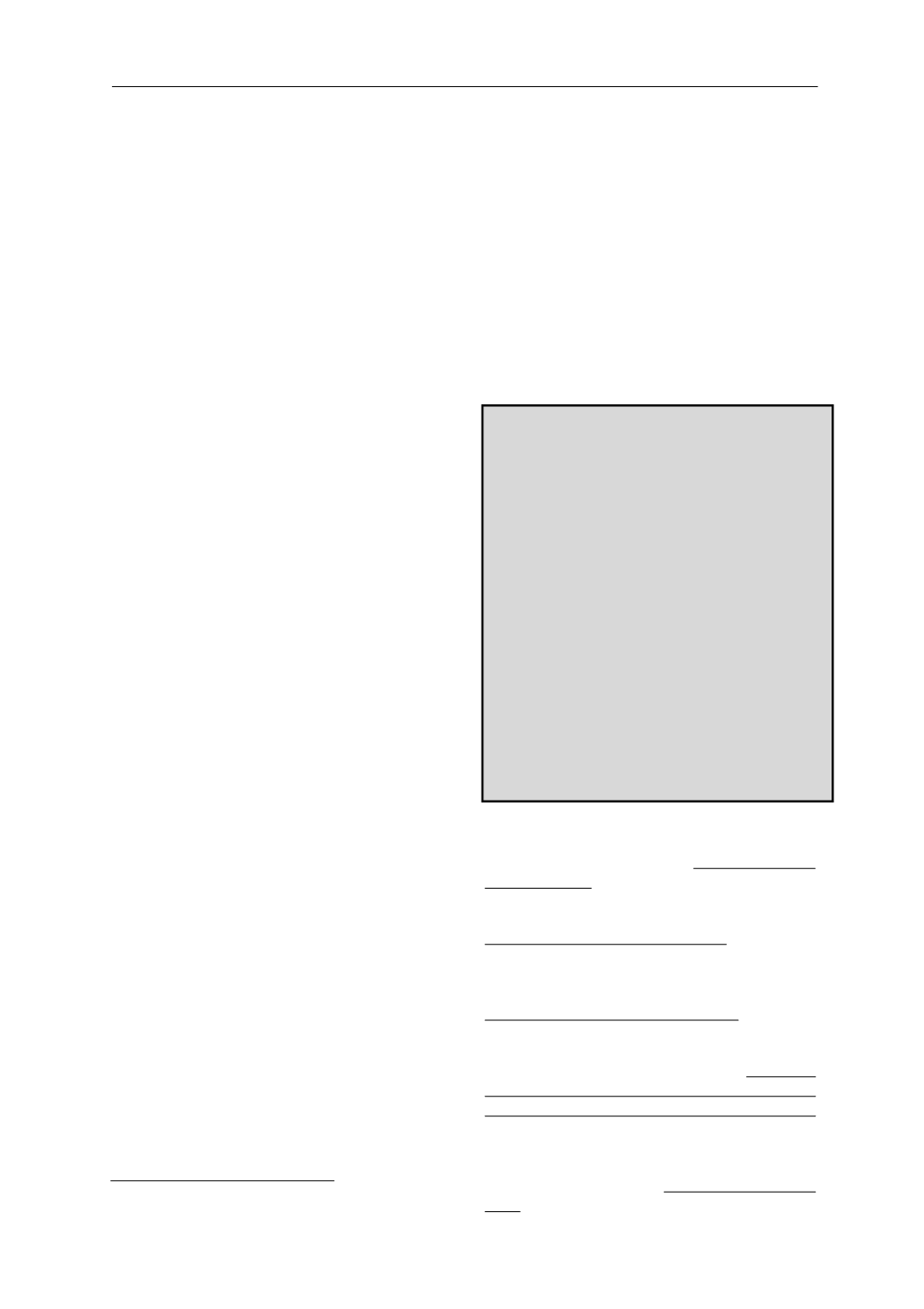
3.2 / 7. Jahrgangsstufe: Persönlichkeitstraining für Kinder und Jugendliche?
72
fi
in das Spielgeschehen pädagogisch
eingreifen, wenn es sinnvoll erscheint.
An die Beendigung der Aktion muss sich
eine Auswertungs- oder Reflexionsphase
anschließen:
26
fi
wenn möglich, die Schülerinnen und
Schüler möglichst viel selbst sprechen
lassen
fi
das Gespräch, falls nötig, auf die ge-
steckten Ziele richten
fi
alle Schülerinnen und Schüler sprechen
lassen
Den Weg mit kleinen Schritten begehen
Lernprozesse, die so in Gang gesetzt wer-
den sollen, erfordern behutsames Vorge-
hen. Da alle Prozesse eng mit persönlichen
Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler
verknüpft sind, ist größte Vorsicht im Um-
gang mit deren Psyche Voraussetzung. Vor
allem bei ganz- oder mehrtägigen Veran-
staltungen ist vor Durchführung unbedingt
zu überlegen, wie bei einer Belastungsre-
aktion eines Schülers konkret gehandelt
werden kann. Sinnvoll ist es, eine Art Not-
fallplan (mit Telefonnummern und Kontakt-
adressen) für solche Situationen zu erstel-
len und während der Aktion parat zu ha-
ben. Geeignete Ansprechpartner (z. B.
Schulpsychologen) können aber auch di-
rekt in den Prozess eingebunden werden.
Es ist zudem nicht möglich mit komplexen
Aufgaben (wie im Fallbeispiel beschrieben)
zu starten, vielmehr müssen die Schülerin-
nen und Schüler durch geeignete Spiel-
und Übungsformen langsam an dieses
Verfahren herangeführt werden. Vielfach
scheitern Aufgaben schon aufgrund von
Vorurteilen, Berührungsängsten, Schamge-
fühl oder der Planung in Zeit und Raum im
Bereich Schule. Wie der Weg modellhaft
von vorbereitenden Übungen bis zu kom-
plexeren Aufgabenstellungen beschritten
werden kann, soll durch ein allgemeines
Unterrichtsmodell, in welches Bausteine
der Arbeitsblätter 1–4 eingefügt werden
können, aufgezeigt werden.
26
Dafür sollte entsprechend Zeit eingeplant werden.
Ausblick
Allen positiven Effekten zum Trotz sei hier
noch einmal darauf hingewiesen:
Lehrkräfte sind weder Psychologen noch
Psychotherapeuten und fachlich aus-
schließlich pädagogisch qualifiziert. Für
Lehrkräfte bleibt somit nur ein pädagogi-
scher Zugang, den man auch konsequent
verfolgen sollte. Der im Folgenden be-
schriebene ‚erfahrungsorientierte‘ Weg ist
nicht allgemeingültig und sollte im Kontext
anderer Möglichkeiten gesehen werden.
Literatur
Asendorpf, Jens B. (2007): Psychologie der
Persönlichkeit, Heidelberg: Springer.
Gilsdorf, Rüdiger/Kistner, Günter (1995):
Kooperative Abenteuerspiele, Seelze-
Velber: Friederich-Verlag.
Gilsdorf, Rüdiger/Kistner, Günter (2001):
Kooperative Abenteuerspiele 2, Seelze-
Velber: Friederich-Verlag.
Hemminger, Hans-Jörg (1996): Eine Er-
folgspersönlichkeit entwickeln. Psychokur-
se und Erfolgstechniken in der Wirtschaft.
(=EZW-Texte Nr. 132, VII/1996), Stuttgart.
Vernon, P.E. (1987): „Persönlichkeit“ in:
Arnold, W. u. a. (1987): Lexikon der Psycho-
logie Bd. 2, Freiburg, S. 1576–1581.
Als
erprobte Leitlinien für Persönlich-
keitstrainings
mit Schülerinnen und
Schülern können gelten:
Keine Ideologisierungen!
Beachtung eines realistischen Menschen-
bildes!
Niemanden unter Druck setzen!
Die Freiwilligkeit betonen!
Nur Aufgaben verwenden, die ich kenne
und möglichst schon selbst erlebt habe!
Der Prozess steht im Vordergrund. Nicht
das Ergebnis!
Keine Überforderungen!