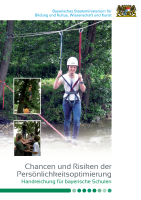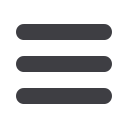
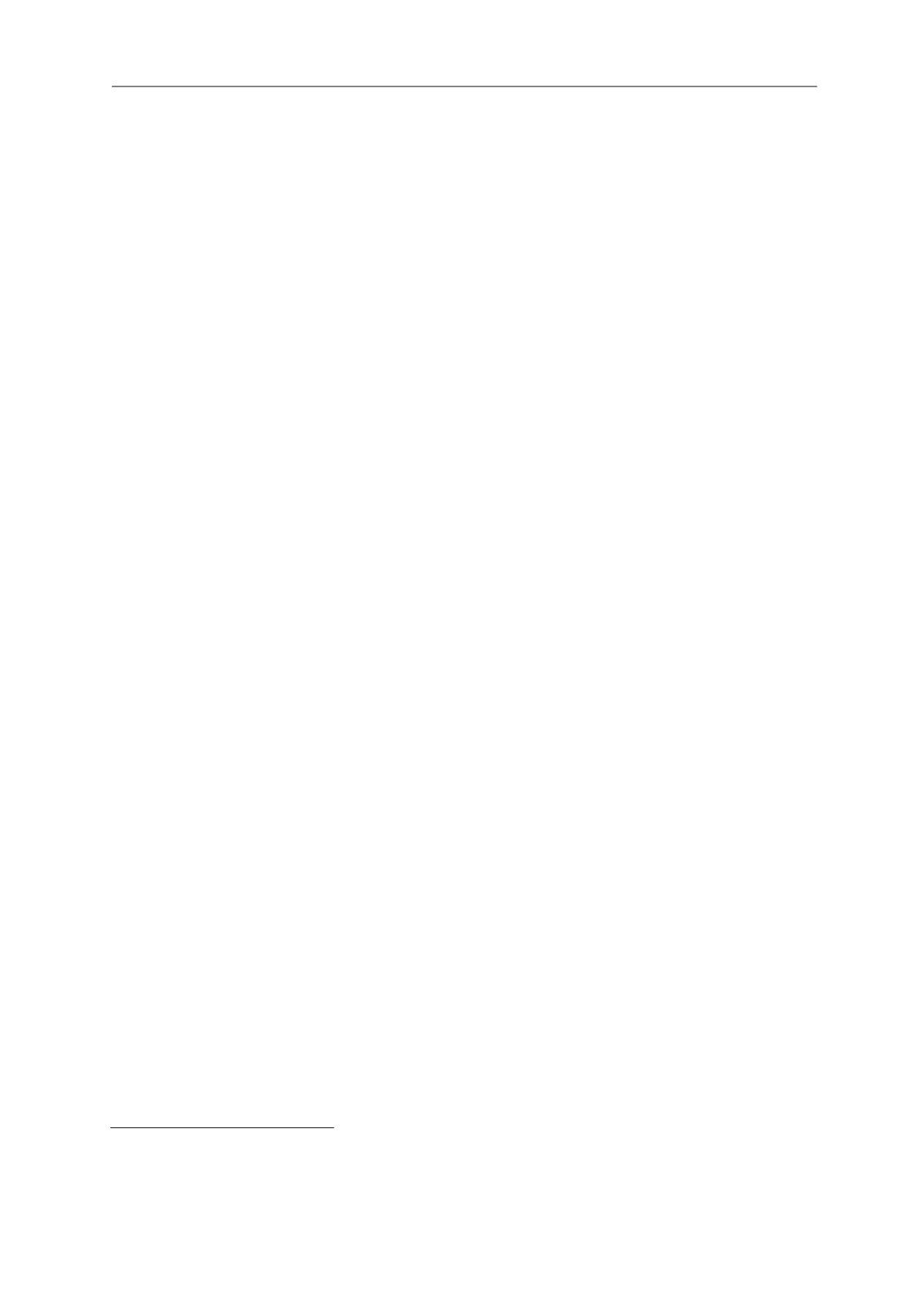
3.2 / 7. Jahrgangsstufe: Persönlichkeitstraining für Kinder und Jugendliche?
69
... bei ehemaligen Schülerinnen und Schü-
lern so gering ausgebildet sind.
Die Intention eines sich weiterentwickeln-
den Bildungssystems muss es daher
durchaus sein, weitere Methoden und Ver-
fahren in den Unterricht einzubringen, die
Schülerinnen und Schüler in ihrer Selbst-
und Sozialkompetenz und ihrer Zielorientie-
rung unterstützen.
Ebenso sollten den Schülerinnen und
Schülern Anhaltspunkte für eine persönli-
che Beurteilung von Persönlichkeitstrai-
nings vermittelt werden.
Fallbeispiel
Einer Gruppe von Schülerinnen und Schü-
ler wird folgende Aufgabe gestellt:
Ihr müsst einen elektrischen Draht
23
über-
queren. Die Aufgabe gilt als gelöst, wenn
ihr euch alle auf der anderen Seite des
Drahtes befindet. Wenn bei der Überque-
rung einer von euch den „Draht“ berührt,
dann muss die ganze Gruppe wieder zu-
rück.
Folgende Aktivitäten und Rückmeldungen
sind in der Klasse (gemischt Mädchen und
Jungen) während der Spielaktion auszu-
machen:
fi
Die Ss A, B und C nehmen Anlauf und
springen über das Seil.
fi
Die Ss D, E, F und G versuchen für die
(motorisch schwächeren) Ss H und I ein
menschliches Podest zu bauen, damit
diese einfacher über den Draht können.
fi
Der Schüler J wendet ein, dass es am
Ende für die letzten wohl schwierig
werden könnte, aber keiner hört ihm zu
(J gilt innerhalb der Klasse eher als Au-
ßenseiter).
fi
K berührt beim Versuch L zu helfen den
Draht, er wird von den Mitschülern be-
schimpft, weil jetzt alle wieder zurück-
müssen.
23
Dazu wird ein circa sechs Meter langes Seil in
Hüfthöhe an einem Ende an einem Baumstamm fest-
gebunden, am anderen von der Lehrkraft gehalten.
fi
M ist heilfroh, dass sie den Draht nicht
berührt hat, hält sich sehr im Hinter-
grund, hat aber schon Angst, dass sie
beim nächsten Mal die „Schuldige“ sein
könnte.
fi
N will O nicht anfassen, weil...
fi
Mehrere Versuche der Schülerinnen
und Schülern scheitern.
fi
Die Lehrkraft bricht die Spielaktion nach
30 Minuten ab, weil die Schülerinnen
und Schüler zur nächsten Unterrichts-
stunde pünktlich im Klassenzimmer
sein müssen.
fi
Die Klasse geht unzufrieden auseinan-
der, eine Gruppe ist sich einig, dass
das Spiel nicht funktionieren könne,
weil P und Q einfach zu dick seien.
Ziele
Folgende Ziele sind – analog zu den Zielen
dieser Unterrichtseinheit – für die Aufga-
benstellung im Fallbeispiel denkbar:
Selbstständigkeit:
fi
eigene Gefühle verbalisieren
fi
den Mut haben, Neues zu erleben
fi
die eigenen Stärken und Schwächen
kennen lernen
fi
Grenzen kennen lernen
fi
sich in Konfliktsituationen zurechtfinden
Teamfähigkeit:
fi
gemeinsam planen
fi
sich verbal über das Problem austau-
schen
fi
Ideen einbringen
fi
alle arbeiten zusammen
fi
in der Gruppe aktiv mitarbeiten
fi
andere Vorschläge tolerieren
fi
sich in andere einfühlen
Kommunikationsfähigkeit:
fi
die Grundregeln der Gesprächsführung
wie laut und deutlich sprechen, andere
ausreden lassen, zuhören ... beachten
fi
Diskussionen zulassen und sich daran
beteiligen
fi
argumentieren
fi
Offenheit zeigen
Kreativität:
fi
Geschicklichkeit zeigen
fi
Lösungsansätze entwickeln
fi
Neues ausprobieren