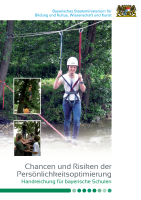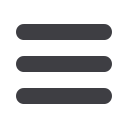
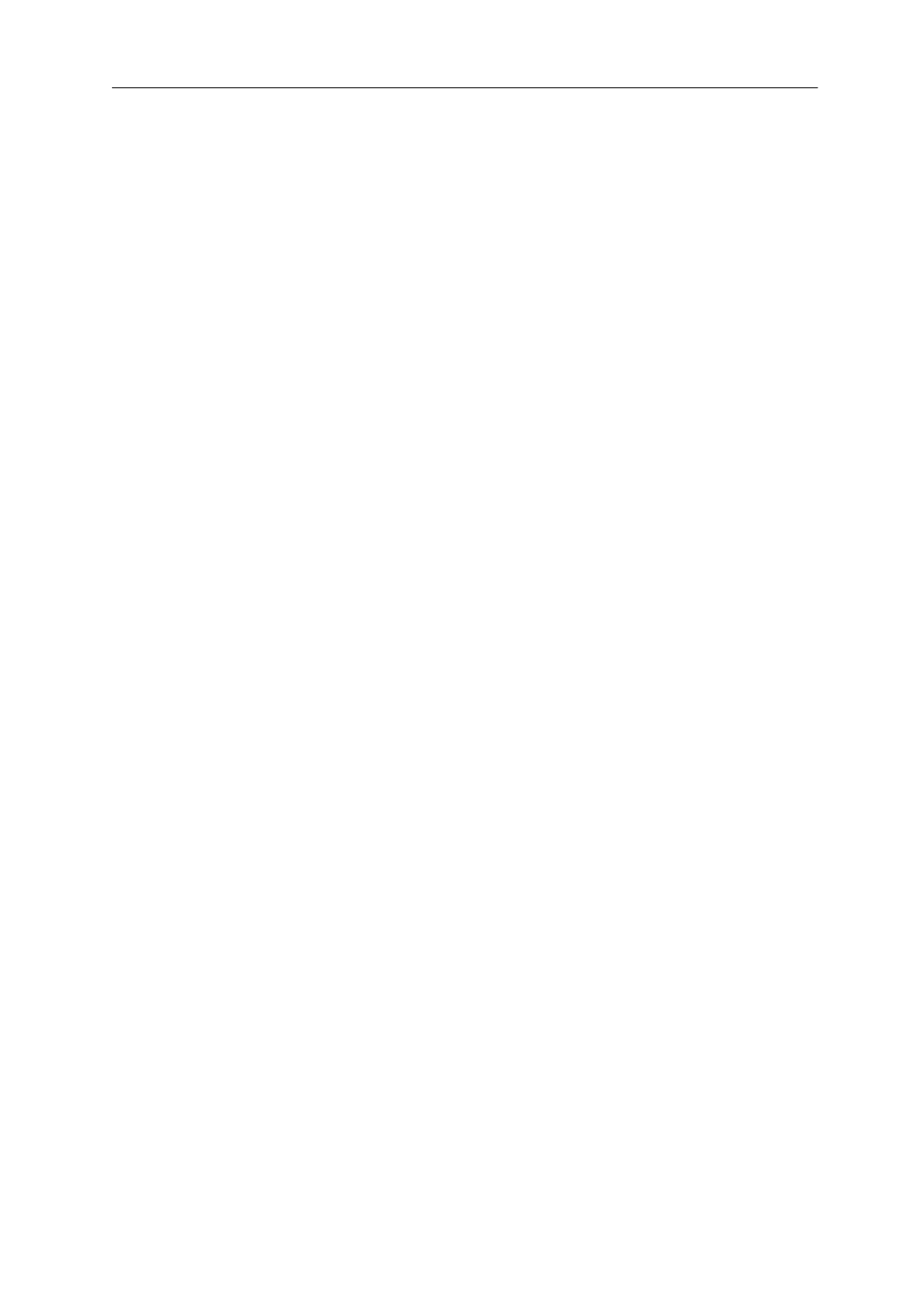
3.1 / Sekundarstufe I/II: Körperkult im Alten Rom und heute – oder: was wirklich zählt
65
Collage von jungen Menschen der Gegen-
wartskulturen (Folie 5). Der Herrscher der
Renaissance (Heinrich VIII) zeigt seine
königliche Macht durch seine Amtsinsigni-
en Robe und Kette, aber vor allem auch
durch körperliche Fülle und Muskeln, sowie
durch sein Mienenspiel (er weiß, was er
will). Die Damen in der Kunst des späten
Mittelalters und der Renaissance wissen
ihre Körper zu präsentieren, verwenden
Kosmetik, Haarfarbe, zeigen sich erotisch-
sinnlich, mit makellosen Körpern und wei-
ßer Haut, als Zeichen des edlen und mühe-
losen Lebens. Aufklärung und Reformation,
ja, der Trend zum Praktischen, kennzeich-
nen das Bild von Jan Vermeer. Die Frau ist
wieder fülliger als Zeichen des bescheide-
nen Auskommens, aber – calvinistisch ge-
prägt – jenseits von Überfluss und Tand.
Sie ist Küchenmagd oder Hausverwalterin,
sie trägt Kleidung, die passend für ihre Tä-
tigkeit im Haushalt ist.
Tüchtigkeit
könnte
über diesem Bild stehen, tüchtig ist auch ihr
Auftreten. Die Bilder von jungen Menschen
der Gegenwartskultur (
Prinzessin, Sportler,
Ethno, Punk
) spiegeln das Grundmuster
seit der Mitte des 20. Jahrhunderts wieder
– standardisierte Individualität und Plurali-
tät in allen Bereichen der Gesellschaft,
auch in Körper- und Schönheitsfragen.
Unterschiedliche Typen von Frauen und
Männern (blond, dunkelhaarig, schlank,
üppigere weibliche und männliche Körper-
formen, …) können sich mit unterschiedli-
chen Stars in Film, Fernsehen und Wer-
bung identifizieren, wobei im europäisch
und amerikanisch geprägten Raum ge-
pflegte
sportlich-dynamisch
geprägte
Schönheitsideale den Trend prägen. Hier
schließt sich der Kreis zum Schönheitsideal
der Antike wieder. Anhand einer Beschrei-
bung des Philosophen Seneca (Arbeitsblatt
1:
Sen.ep.56,1f.) werden von den Schüle-
rinnen und Schülern in Partnerarbeit we-
sentliche Aspekte des Körperkults im Alten
Rom erarbeitet; durch die entsprechende
Bezeichnung mit modernen Begriffen (Ta-
felbild:
Bodybuilding, Wellness, Epilieren
)
ist der Vergleich mit heute im Prinzip voll-
zogen. Interessant sind die Pinzetten aus
der Kaiserzeit (Arbeitsblatt 2/Folie 6), die
Vorläufer der heutigen Epiliergeräte. Wäh-
rend es in der Unter- und Mittelstufe ge-
nügt, die Pinzetten anhand einer Folie zu
zeigen, ist es in der Oberstufe sinnvoll, die
Abbildung der Pinzetten samt Informations-
text über Enthaarung (Arbeitsblatt 2) den
Schülerinnen und Schülern an die Hand zu
geben. Bei dem Dichter Catull (Arbeitsblatt
3: Cat.c. 43) ist uns ein römisches Schön-
heitsideal für das 1.Jh.v.Chr. überliefert,
das unter einem anderen Blickwinkel die
Betonung des Körperlichen zeigt, auch
wenn es zur damaligen Zeit Schönheits-
operationen im heutigen Sinne noch nicht
gab. Im Lateinunterricht in der 9. bzw. 11.
Jahrgangsstufe sollte das Gedicht nicht in
Einzelarbeit, sondern als gemeinsame Lek-
türe behandelt werden. Ein Vergleich mit
etwaigen heutigen Schönheitsidealen wird
den Schülerinnen und Schülern verdeutli-
chen, wie unterschiedlich Geschmack sein
kann. Hier kann noch einmal auf die unter-
schiedlichen Bilder am Anfang der Stunde
hingewiesen werden. Wiederum Seneca
(Arbeitsblatt 4:
Sen.ep.15,1–6.11) entwirft
ein Menschenbild, das den Einzelnen nicht
zum Sklaven äußerer Maßstäbe macht
oder ihn in Extremhaltungen krank werden
lässt (z. B. Magersucht), sondern überzo-
genen Ansprüchen eine realistischere
Selbsteinschätzung gegenüberstellt. Die
Betonung von körperlicher und geistiger
Gesundheit schafft Selbstvertrauen und
Selbstbewusstsein angesichts der Sogwir-
kung von Modetrends und führt den Men-
schen zu seinen Wurzeln zurück, zu dem,
was wirklich zählt. Im Lateinunterricht der
11. Jahrgangsstufe sollte der Text nicht in
Partnerarbeit, sondern als gemeinsame
Lektüre behandelt werden. In einem vertie-
fenden Vergleich des Menschenbildes im
Alten Rom und heute sollen sich die Schü-
lerinnen und Schüler der Maßstäbe des
heutigen Körperkultes sowie der (teilweise
überzogenen) Erwartungen an den Einzel-
nen bewusst werden. In einer Gruppenar-
beit tauschen sie sich darüber aus, was
wirklich zählt und wie Leben aus ihrer Sicht
gelingen kann. Die anschließende Präsen-
tation der Ergebnisse im Plenum sollte
deutlich machen, dass es keine für alle
Menschen verbindlichen Kriterien für ge-
lungenes Menschsein gibt, sondern dass
die Erfahrung, wie Leben sinnvoll wird, in
der Verantwortung und Ehrlichkeit des Ein-
zelnen sich selbst gegenüber liegt.