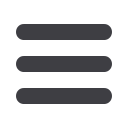

70
Auschwitz überlebt – und dann?
Einsichten und Perspektiven 1 | 16
Verhalten von KZ-Überlebenden. Sie versuchen über das
Schweigen, ihre Kinder vor der unfassbaren Wahrheit zu
bewahren, und sich selbst vor den Erinnerungen.
5
Peter lebt in Giesing, dort, wo er auch vor der Depor-
tation mit seiner Familie wohnte. Und wieder landet er
eines Tages als Kind auf dem Polizeipräsidium in der Ett-
straße. Es ist die Polizeistelle, in der er im März 1943 in
der Sammelzelle gefangen gehalten war, der Ort, an dem
die Deportation nach Auschwitz begonnen hatte.
Es ist Winter, dieWeihnachtstage sind vorbei. Sein Cou-
sin und er haben die Idee, zum Heilig-Drei-König-Singen
zu gehen. Ein alter Brauch. Kinder basteln einen Stern und
klopfen an den Häusern an. Sie singen, hinterlassen einen
Gruß, einen frommen Wunsch und erhalten dafür eine
Gabe. Peter zog als Sternsinger mit seinem Cousin los, um
für sich selbst ein paar Gaben zu erhalten – und landete auf
dem Polizeipräsidium in der Ettstraße.
„Wir sind einmal Heiligdreikönig gegangen. Ich mit
meinem Cousin, der jetzt in Nürnberg wohnt. Da haben
sie uns eingesperrt. Es ist die Polizei gekommen und hat
uns verhaftet. Denn Heiligdreikönig war schon vorbei, und
wir sind trotzdem noch gegangen. Wir wussten nicht, dass
wir das nicht dürfen. Da brachten sie uns in die Ettstraße.“
Sein Onkel musste kommen, um die zwei Kinder
dort abzuholen. Es ist nur eine kleine Anekdote, die dem
Erwachsenen Peter Höllenreiner heute wieder einfällt. Die
Familie ist geblieben an dem Ort, an dem die Schreckens-
erfahrung begann. Als der etwa zehnjährige Peter nun
wieder auf der Polizeistation landete, könnten ihm die
gleichen Polizeibeamten wie damals im März 1943 gegen-
über gestanden haben, die gleichen Wände, die gleiche
Eingangstür, die gleiche Arrestzelle. So könnte es gewesen
sein. Es begann eine zweite Traumatisierung.
Seine Schulbildung blieb dürftig. Berufswege blieben
ihm verschlossen. Er arbeitete zu Hause mit, im Pferde-
stall, beim Pferdehandel, er half seinem Vater, seinen
Onkeln. Er lernte über das Zuschauen und Zuhören.
„Wir haben ein Fuhrunternehmen gehabt. Fuhrunter-
nehmen heißt, mei, die haben halt Umzüge gemacht unter
anderem. Wir haben ein paar Pferde gehabt. Das war sein
[des Vaters Beruf, Anm. d. Verf.], es hat ja von uns Kindern
keiner was g’lernt. Die hätten uns auch nie g’nommen.“
„Die hätten Sie nie g’nommen?“ [in die Lehre zur
Berufsausbildung, Anm. d. Verf.], ich schaue ihn verwun-
dert an.
5 Siehe dazu: Gabriele Rosenthal (Hg.): Der Holocaust im Leben von drei
Generationen. Familien von Überlebenden der Shoah und von Nazi-Tätern,
Gießen
3
1999.
„Nein. Da hätt’ uns niemand … [er schweigt]“.
„Familie ist alteingesessen, galt immer als ehrbar, flei-
ßig, vornehm und ruhig.“ Dies schreibt der Hausarzt der
Familie Höllenreiner im Jahr 1954 in einem Krankheits-
bericht über Peters Vater Josef Höllenreiner zur Vorlage
beim Landesentschädigungsamt. Er wollte vermutlich
dem Vorurteil, das auch nach 1945 unausgesprochen und
unhinterfragt über der Gesellschaft hing, entgegenwirken,
bzw. die gesellschaftliche Stellung der Familie richtig stel-
len. Als Arzt hätte er sich nicht über die Lebensweise der
Familie äußern brauchen, doch er hielt es anscheinend für
notwendig. Der Bericht geht noch weiter: „Keine erbli-
chen Krankheiten. Eltern des Pat. sind hochbetagt, nie im
Leben krank gewesen, noch jetzt arbeitsam.“
Die Militärregierung erkannte zwar Peters Vater und
seine Familie als „rassisch Verfolgte“ an, denn sie waren im
März 1943 deportiert worden, doch das Schriftstück hatte
erst einmal keine weiteren Folgen. Wäre die Deportation
früher erfolgt, wäre ihnen die Anerkennung als Verfolgte
der NS-Diktatur ganz versagt geblieben. Frühere Inhaftie-
rungen wurden in einem Urteil des Bundesgerichtshofes
von 1956 als legitime polizeiliche Maßnahmen festge-
schrieben, begründet mit den angeblichen kriminellen
und asozialen Eigenschaften von „Zigeunern“.
Es gab in den Nachkriegsjahren keine Rehabilitation,
es gab keine gesamtgesellschaftliche Anerkennung der ras-
sisch motivierten Verfolgung von Sinti und Roma, denn
diese hielt im Grunde genommen an, war im Jahr 1993
das Fazit des Historikers Ludwig Eiber.
6
Heute gilt dies
als traurige historische Tatsache. Ein öffentliches Einge-
ständnis, dass der an den Sinti und Roma geschehene Völ-
kermord Unrecht war, gab es weder in den unmittelbaren
Nachkriegsjahren, noch in der Wirtschaftswunderzeit.
Erst im Jahr 1982 gab die Bundesregierung der Bundes-
republik erstmals eine entsprechende Erklärung ab, nach-
dem sich der neu gründete „Zentralrat Deutscher Sinti
und Roma“ dafür eingesetzt hatte.
„Der Zigeuner ist in den Köpfen drin“
,
sagt Peter Höl-
lenreiner im Jahr 2014. Seine Stimme ist kraftlos, leise bei
diesen Worten, wo er sonst so lebendig erzählt. Ausgren-
zung durchzieht sein Leben wie ein roter Faden. War er
später erfolgreich durch Fleiß, durch sein Können, aber
auch mit Glück – hieß es: der Gauner.
6 Ludwig Eiber: „Ich wußte, es wird schlimm“ (Hugo H.). Die Verfolgung der
Sinti und Roma in München 1933–1945. Mit Beiträgen von Eva Strauß
und Michail Krausnick, hg. von der Landeshauptstadt München, München
1993, S. 9.


















