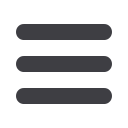
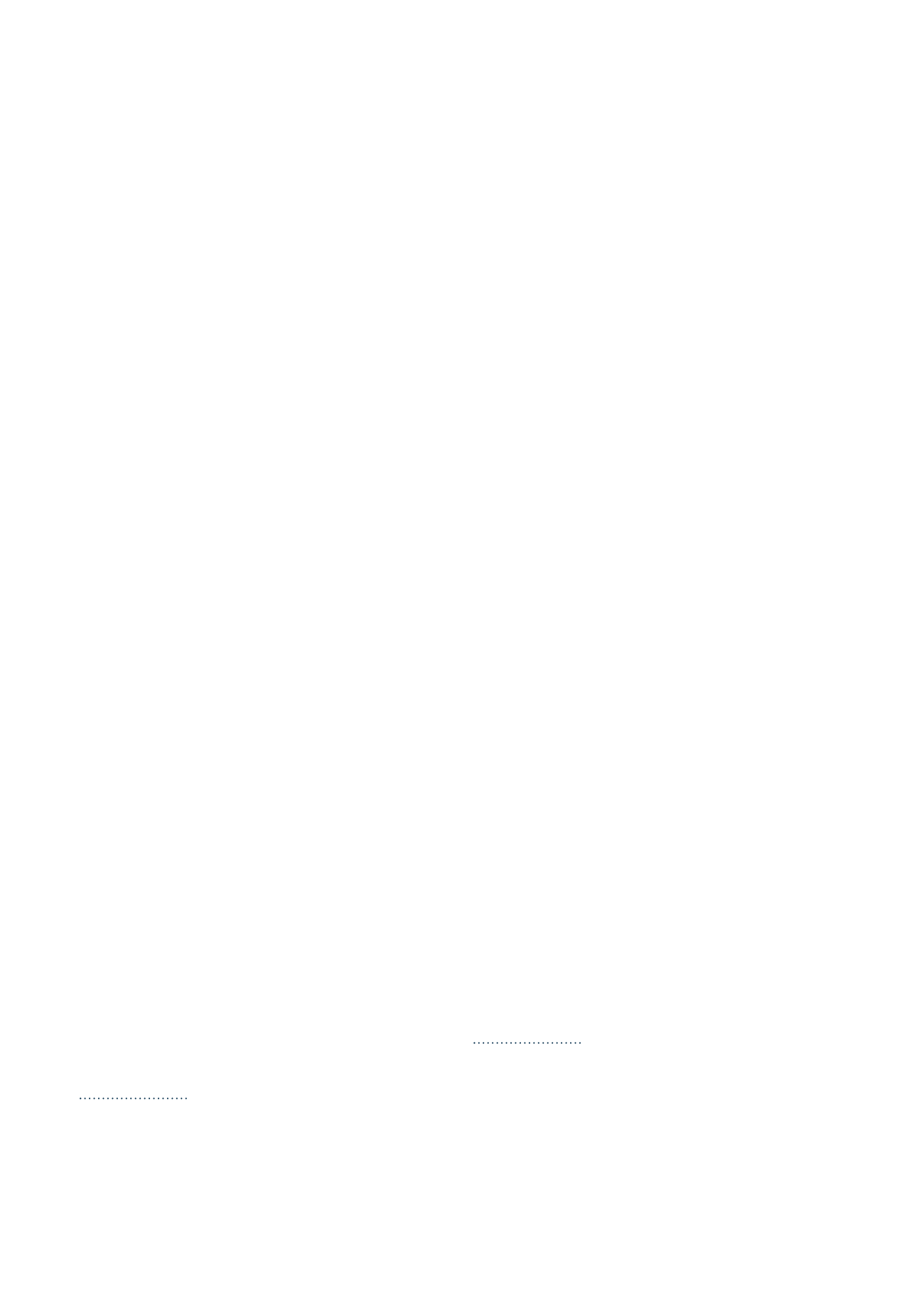
28
Mittler zwischen Ost und West?
Einsichten und Perspektiven 3 | 16
2007 mit dem Vertrag von Lissabon glückte, auch des-
halb oberste Priorität.
Im Umgang mit ihrer Nachbarschaft behielten die EU
und die NATO ihre zuvor formulierten Grundsätze bei.
Sie kultivierten nach den großen Erweiterungsrunden
Kooperations- und Assoziierungsprogramme für Nicht-
Mitglieder, blieben aber prinzipiell offen für weitere Bei-
tritte. Russland gegenüber verstand sich Deutschland
weiter als Brückenbauer in den Westen. Dabei führte aus
deutscher Sicht nur die Demokratisierung und Einbin-
dung Russlands zu stabilen Beziehungen. In der Tradi-
tion der Neuen Ostpolitik versuchte Berlin, mit sanften
Anreizen politische Fortschritte anzustoßen. Den Kurs
„Wandel durch Handel“ hatte man zwar auch vorher
schon verfolgt – und Russlands Rückkehr zu autoritären
Strukturen nicht verhindern können. Doch man hoffte
auf neuen Schub. 2007 legte das Auswärtige Amt ein
Papier mit dem Titel „Annäherung durch Verflechtung“
vor, das der Frage nachging, wie die ins Stocken geratene
Einbindung Russlands in gesamteuropäische Strukturen
belebt werden könne.
26
Ab 2008 sollte eine „Modernisie-
rungspartnerschaft“ u.a. in den Bereichen Wissenschaft,
Bildung, Klima- und Energiepolitik sowie Justiz- und
Rechtsstaatsfragen Kooperationspotenziale erschließen.
Doch das Interesse an politischen Reformen erwies sich
als zu einseitig.
27
Stattdessen verschärften sich die Spannungen. Bei
der Münchner Sicherheitskonferenz von 2007 geißelte
Putin die internationale Dominanz der USA und die
NATO-Osterweiterung. Die Aufnahme neuer Mitglie-
der spalte Europa und sei eine Provokation für Russ-
land.
28
Aus Rücksicht auf Moskau verhinderte die Bun-
desregierung 2008 einen Beitrittsfahrplan für Georgien
und die Ukraine, den die USA befürwortet hatten. Ob
die Öffnung westlicher Institutionen für interessierte
Staaten oder ihr Ende zu mehr Stabilität führten, war
nun wieder offen. Das völkerrechtswidrige Vorgehen
Russlands im Georgienkrieg 2008 verkomplizierte eine
Antwort. „Rückfälle in alte Denkmuster, Abgrenzungs-
rhetorik, vor allem der Krieg in Georgien im Sommer
letzten Jahres, haben uns gezeigt, dass wir vom Ziel
einer dauerhaften Friedensordnung in Europa, die
Nordamerika und Russland einschließt, noch weit ent-
26 Vgl. Spanger (wie Anm. 20), S. 654.
27 Vgl. Stefan Meister: Zeit für einen Wandel. Deutschlands Russlandpolitik
auf dem Prüfstand, in: WeltTrends 21 (2013), H. 89, S. 70–77.
28 Vgl. Jochen Bittner: Sicherheitskonferenz. Kein Grund zur Beruhigung, in:
Die Zeit v. 12.02.2007.
fernt sind“, stellte Außenminister Frank-Walter Stein-
meier 2009 fest.
29
Tatsächlich manifestierten sich in der russischen Außen-
politik zunehmend Züge, die inkompatibel waren mit der
europäischen Ordnung, für die sich die Bundesrepublik
mit ihren Partnern einsetzte. Während aus westlicher
Sicht die Zeit des Einflusssphären- und Nullsummenden-
kens vorbei war, traf dies aus russischer Sicht nicht zu.
Mit der wirtschaftlichen Erholung und autoritären Kon-
solidierung des Landes wurde die Sicherung einer eigenen
Einflusszone zum Kern von Moskaus Nachbarschaftspo-
litik. Sie basiert auf der Prämisse, dass Russland legitime
Vorrechte im postsowjetischen Raum besitze, und operiert
mit Anreizen, Klientelstrukturen und Zwang, um Nach-
barn zu binden. Demokratische, rechtsstaatliche, markt-
wirtschaftliche Reformen gefährden demnach russischen
Einfluss. Die politische Elite um Wladimir Putin konst-
ruiert indes das Narrativ, dass Russland durch die NATO
bedroht werde und die EU als „Türöffner“ für die Atlan-
tische Allianz fungiere. Seit 2008 investiert Moskau in das
Militär und konzipiert Methoden der „hybriden Kriegs-
führung“ im Graubereich zwischen Krieg und Frieden.
Dazu gehört auch, dass russische Staatsmedien mit Desin-
formation gezielt ein ausländisches Publikum adressieren.
Während die Europäer auf einen westlichen Werte und
Ordnungskonsens gehofft hatten, versteht sich Russland
als anti-westliche Großmacht mit eigenem Gestaltungsan-
spruch.
30
Ab 2014 trat dieser Gegensatz voll zu Tage, nachdem
Russland im November 2013 durch Druck auf den pro-
russischen Präsidenten der Ukraine die Unterzeichnung
eines EU-Assoziierungsabkommens verhindert hatte.
Auf den pro-westlichen Machtwechsel in Kiew antwor-
tete es mit der Annexion der Krim und der gewaltsamen
Destabilisierung der Ostukraine. Deutschland verurteilte
das russische Vorgehen scharf und suchte zusammen
mit seinen europäischen und transatlantischen Partnern
nach Antworten. Berlin übernahm eine Führungsrolle
beim Krisenmanagement, das die politische Unterstüt-
zung der Ukraine, die Sanktionierung Russlands und die
29 Frank-Walter Steinmeier: Rede in der Akademie der Wissenschaften in
Moskau, 10.06.2009,
<www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Reden/2009/090610-BM-Moskau.html> [Stand: 06.09.2016].
30 Vgl. z.B. Martin Malek: Die neue europäische Sicherheitsordnung – die
Sichtweise Russlands, in: „Gesamteuropäische Friedensordnung 1989–
2009“, hg. v. Michael Staack, Bremen 2010, S. 97–117; Uwe Halbach:
Russland im Wertekampf gegen »den Westen«. Propagandistische und
ideologische Aufrüstung in der Ukraine-Krise, SWP-Aktuell 43 (Juni
2014), S. 1–4.


















