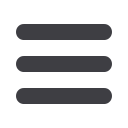

25
Mittler zwischen Ost und West?
Einsichten und Perspektiven 3 | 16
So abgesichert lud die Allianz im Juli 1997 Polen, Tsche-
chien und Ungarn zu Beitrittsgesprächen ein, die 1999 in
der Aufnahme mündeten. Die Bundesrepublik vermittelte
in der NATO eine weitere Kompromissformel. Das Bünd-
nis würde sich, wie von den USA befürwortet, in der ers-
ten Erweiterungsrunde auf drei Kandidaten beschränken,
sich aber offen für alle europäischen Demokratien zeigen.
Explizit genannt wurden Rumänien und Slowenien, deren
Einbeziehung Frankreich schon 1997 gefordert hatte,
sowie die baltischen Staaten.
14
Damit war ein Arrange-
ment gefunden worden, das alle Beteiligten befriedigte.
15
Parallel dazu veränderte sich aufgrund externer
Zwänge das Aufgabenspektrum der Allianz. Neben der
kollektiven Verteidigung rückten friedensschaffende und
-sichernde Einsätze außerhalb des Bündnisgebiets ins
Blickfeld. Der blutige Zerfall Jugoslawiens entwickelte
sich mit dem Bosnienkrieg und dem Kosovokonflikt
zum Katalysator. Russland sah besonders beim nicht-
UN-mandatierten Krieg gegen Serbien 1999 seine Macht
bedroht, weil es das serbische Vorgehen im Kosovo als
innere Angelegenheit betrachtete und die Intervention
trotz seines Vetorechts im UN-Sicherheitsrat nicht ver-
hindern konnte. Deutschland stand – ungeachtet heftiger
innenpolitischer Debatten – fest an der Seite seiner west-
lichen Partner. Unkontrolliert eskalierende und grausam
geführte Konflikte wie die in Bosnien und im Kosovo, wo
nationalistische Auswüchse zu ethnischen Säuberungen
führten, gefährdeten schließlich jenen positiven Frieden,
den man zu gestalten hoffte.
Den Ausgleich zu Moskau suchte die Bundesrepublik
durchgängig: In den 1990er Jahren war es Helmut Kohls
hervorragendes Verhältnis zum russischen Präsidenten
Boris Jelzin, das trotz russisch-westlicher Differenzen einen
intensiven Dialog sicherte. 1999 half eine Initiative des
deutschen Außenministers Joschka Fischer, Russland an
der Seite der NATO bei der Stabilisierung des Kosovo ein-
zubinden.
16
Deutschland agierte wiederholt als Vermittler
und suchte Anknüpfungspunkte für Russland. Dass es die
im westlichen Verbund formulierte Ordnungskonzeption
teilte, weil sie eine gesamteuropäische Friedensordnung
auf der Basis der Charta von Paris versprach, stand indes
nicht in Zweifel.
14 Vgl. Bierling (wie Anm. 6), S. 40.
15 Generell zur NATO-Osterweiterung und der deutschen Rolle vgl. Marco
Overhaus: Die deutsche NATO-Politik. Vom Ende des Kalten Kriegs bis zum
Kampf gegen den Terrorismus, Baden-Baden 2009, S. 84–164.
16 Vgl. Bierling (wie Anm. 6), S. 128 f.
Neue deutsche „Mittellage“ statt Vermittlung?
Während sichDeutschland in den 1990er Jahren bemühte,
als berechenbarer Partner aufzutreten, bewährte Strategien
der Integration und Institutionalisierung voranzutreiben
und diese für Gesamteuropa zu adaptieren, veränderte
sich unter Kanzler Gerhard Schröder der Ton. Schröder
verstand das als eine „Normalisierung“ der deutschen
Außenpolitik. Zwar bekräftigte er in seiner ersten Regie-
rungserklärung vom November 1998: „Wir bekennen uns
uneingeschränkt zu unserer Verankerung im westlichen
Bündnis und in der Europäischen Union.“ Gleichzeitig
beschrieb er das „Selbstverständnis einer erwachsenen
Nation, die sich niemandem über-, aber auch nieman-
dem unterlegen fühlen muß, die sich der Geschichte und
ihrer Verantwortung stellt, aber bei aller Bereitschaft, sich
damit auseinanderzusetzen, doch nach vorne blickt.“
17
In der Europapolitik wollte Schröder stärker nationale
Interessen formulieren und forderte etwa eine Reduzie-
rung der deutschen Nettozahlungen. Das Verhältnis zu
den USA verschlechterte sich nach den Terroranschlä-
gen vom 11. September 2001 im Verlauf des „Kriegs
gegen den Terror“ und der Irakkriegsdebatte 2002/2003
zusehends. Schröder stellte sich mit Frankreich und
Russland offen gegen den traditionellen Verbündeten
USA. Dabei war weniger befremdlich, dass die Bundes-
republik den Irakkrieg ablehnte, als vielmehr die Art,
wie sie mit einer „Achsenbildung“ gegen Washington
opponierte. Die Spaltung der EU beförderte die Hal-
tung obendrein. Selbst die NATO erfuhr eine gewisse
Relativierung, da der Ausbau verteidigungspolitischer
Strukturen in der EU mit dem Vertrag von Nizza 2001
als potenzielle Alternative zur euro-atlantischen Koope-
ration erschien.
18
Das Verhältnis zu Russland, insbesondere zu Präsi-
dent Wladimir Putin, entwickelte dagegen während der
Kanzlerschaft Schröders sehr persönliche Züge, was auch
politisch zu einer Annäherung führte. Bei den deutsch-
russischen Regierungskonsultationen 2000 wurde eine
bilaterale „strategische Partnerschaft“ beschlossen. Als
erster russischer Präsident hielt Putin 2001 eine Rede im
Deutschen Bundestag, in der er die besonderen Beziehun-
gen beider Länder und das daraus erwachsende Potenzial
zur Gestaltung der europäischen Ordnung jenseits beste-
17 Gerhard Schröder: Regierungserklärung vom 10.11.1998, <dip21.bundestag.
de/dip21/btp/14/14003.pdf> [Stand: 05.09.2016].
18 Vgl. Hanns W. Maull: „Normalisierung“ oder Auszehrung? Deutsche Außen-
politik im Wandel, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B11 (2004), S. 17–23.


















