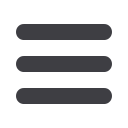

24
Mittler zwischen Ost und West?
Einsichten und Perspektiven 3 | 16
großes Verständnis entgegenbrachte.
11
Stattdessen richtete
die NATO 1994 mit der „Partnerschaft für den Frieden“
(PfP) ein weiteres Assoziierungsprogramm ein, zu dem
auch Russland eingeladen war.
Ab 1994 ging es letztlich nicht mehr um die Frage,
ob sich die NATO öffnen würde, sondern um das Wie.
Schließlich war ein Vakuum mit Sicherheitsdilemmata im
Osten Europas in niemandes Interesse. Außerdem ließen
sich mit strengen Kriterien (z.B. zivile Kontrolle des Mili-
tärs; demokratische Verfasstheit des Staates) die Reformpro-
zesse der Beitrittskandidaten unterstützen. Für Deutschland
war zudem wichtig, die Stabilisierung der östlichen Nach-
barschaft zu einer Gemeinschaftsaufgabe zu machen. Das
Weißbuch des Bundesverteidigungsministeriums von 1994
folgerte: „Das klare Signal, für neue Mitglieder offen zu
sein, ist ein wichtiger Beitrag der NATO zur Stabilisierung
des östlichen Europa. Integration und Kooperation sind die
tragende Elemente eines vernünftigen Gesamtkonzeptes für
die europäische Stabilität.“
12
Zugleich befürworteten Kanz-
ler Kohl und Außenminister Klaus Kinkel mit Rücksicht
auf Russland weiter eine abwartende Linie.
11 Vgl. Varwick (wie Anm. 9), S. 99 f.
12 Bundesministerium der Verteidigung: Weißbuch 1994 zur Sicherheit der
Bundesrepublik Deutschland und zur Lage und Zukunft der Bundeswehr,
Bonn 1994, S. viii–ix.
Eine Erweiterung musste, dafür setzte sich die Bundes-
regierung von Anfang an ein, Hand in Hand gehen mit
dem Beziehungsaufbau zu Russland. Zwar hatte es weder
eine Abmachung gegeben, die NATO nicht für neue Mit-
glieder zu öffnen, noch besaß Russland ein Vetorecht über
die politischen Weichenstellungen souveräner Staaten.
Doch es sollte verhindert werden, dass die Erweiterung
der Allianz missverstanden würde als ein gegen Russland
gerichteter Schritt. Die defensive Ausrichtung der NATO
zu betonen, reichte dazu nicht aus.
Die NATO-Russland-Grundakte vom Mai 1997, bei
deren Verhandlung Deutschland eine Führungsrolle über-
nommen hatte, hob das bilaterale Verhältnis auf eine neue
Stufe. Darin bekannten sich Russland und die NATO
zum Aufbau einer engen Partnerschaft und zum „Bau
eines stabilen, friedlichen und ungeteilten, geeinten und
freien Europas“. Zur Konsultation und Koordination
sollte ein „Gemeinsamer Ständiger NATO-Russland-Rat“
dienen. Außerdem verpflichtete sich die NATO, auf die
ständige Stationierung von Kampfverbänden und Nukle-
arwaffen in den neuen Mitgliedsländern zu verzichten.
13
13 Vgl. Grundakte über Gegenseitige Beziehungen, Zusammenarbeit und Si-
cherheit zwischen der Nordatlantikvertrags-Organisation und der Russi-
schen Föderation, 27.05.1997,
<www.nato.diplo.de/contentblob/1940894/Daten/.../1997_05_Paris_DownlDat.pdf> [Stand: 06.09.2016].
Gruppenbild nach der Unterzeichnung der NATO-Russland-Grundakte, 27. Mai 1997
Bild: picture-alliance/dpa


















