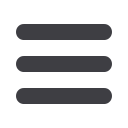
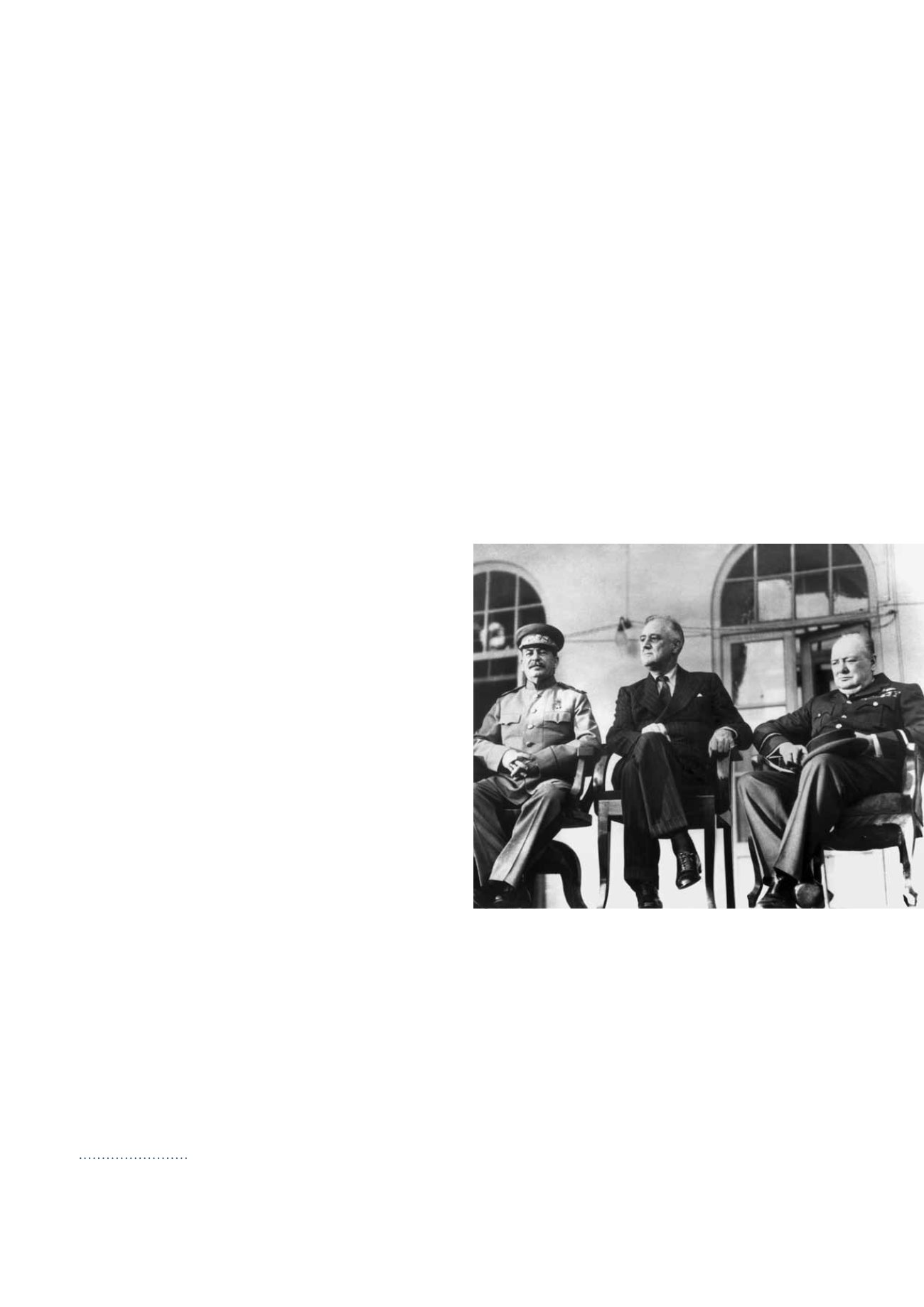
19
Mittler zwischen Ost und West?
Einsichten und Perspektiven 3 | 16
Deutschlands Bemühen um eine stabile Friedens
ordnung in Europa
Das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen hat
seit 2014 mit Moskaus völkerrechtswidriger Annexion
der Krim und der Destabilisierung der Ostukraine einen
vorläufigen Tiefpunkt erreicht. Während nach dem Ende
des Ost-West-Konflikts die Hoffnung auf ein geeintes und
freies Gesamteuropa erwachsen war, warnen Beobachter
heute vor den Gefahren eines „neuen Kalten Kriegs“.
Wörtlich verstanden führt dies zwar in die Irre, da die
globale ideologische und machtpolitische Blockkonfron-
tation des Kalten Kriegs keine Renaissance erfährt. Im
übertragenen Sinne besitzen die Warnungen aber einen
wahren Kern: Es ist in den vergangenen 25 Jahren nicht
gelungen, eine stabile, auch von Russland akzeptierte
gesamteuropäische Friedensordnung zu schaffen.
Die Bundesrepublik Deutschland hat sich seit der Zei-
tenwende von 1989 bis 1991 besonders um den Bau eines
„gemeinsamen Hauses Europa“ bemüht. Sie trat dabei
immer wieder als Vermittler zwischen Ost und West in
Erscheinung. Der folgende Beitrag analysiert die Entwick-
lung und Ausgestaltung dieser Mittlerrolle. Dies bietet die
Chance, die zentralen Leitlinien deutscher Außenpoli-
tik und die politischen Weichenstellungen des Westens
genauer zu beleuchten. Wenn heute russischer Revisio-
nismus als natürliche Reaktion auf die „Expansion“ der
Nordatlantischen Vertragsorganisation (NATO) und der
Europäischen Union (EU) interpretiert wird,
1
impliziert
dies, dass beide rücksichtslos eine eigene Agenda verfolgt
hätten und Europa ohne ihre Politik der offenen Tür heute
besser dastünde. Der Blick in die Geschichte bestätigt dies
nicht. Die Weiterentwicklung westlicher Institutionen
war im historischen Kontext betrachtet folgerichtig. Sie
war geleitet von dem Bestreben, die Friedensordnung in
Westeuropa zu erhalten, die Transformation Osteuropas
zu unterstützen und den politisch nach Westen drängen-
den mittel- und osteuropäischen Staaten Perspektiven zu
bieten. Flankiert wurde es vom Bemühen um eine enge
Partnerschaft mit Moskau. Die Schaffung eines geeinten
Gesamteuropas setzte allerdings einen ordnungspoliti-
schen Konsens voraus. Doch Russland, das einst auf dem
Weg nach Westen schien, kehrte unter Präsident Wladi-
mir Putin zurück zu autoritären Strukturen im Inneren
und Großmachtambitionen nach außen. Für die deutsche
Außenpolitik ist dies eine große Herausforderung.
1 Vgl. John J. Mearsheimer: Why the Ukraine Crisis is the West’s Fault, in:
Foreign Affairs 93 (2014), H. 5, S. 77–89.
Die bundesrepublikanischen Anfänge: Westintegra
tion und Neue Ostpolitik
Um Deutschlands außenpolitischen Kurs nach dem Ende
des Ost-West-Konflikts nachvollziehen zu können, müs-
sen die Erfahrungswerte der Bundesrepublik bis zur Wie-
dervereinigung betrachtet werden. Nach dem Sieg über
Hitler-Deutschland im Zweiten Weltkrieg zeichnete sich
zwischen der Sowjetunion und den westlichen Alliier-
ten unter der Führung der USA ein neuer Konflikt ab,
der bereits 1947 als „Kalter Krieg“ charakterisiert wurde
und die Weltpolitik jahrzehntelang prägen sollte. Es stan-
den sich konkurrierende Ordnungssysteme gegenüber:
Diktatur, Kommunismus, Gleichschaltung, Zwang und
Planwirtschaft im Osten versus Demokratie, Rechts-
staatlichkeit, Freiheit, Pluralismus und Marktwirtschaft
im Westen. Deutschland, das nach der bedingungslosen
Kapitulation 1945 zunächst in Besatzungszonen geteilt
war, lag an der Bruchstelle zwischen Ost und West.
Schon 1946 wurden Grundsatzdebatten zur künftigen
Rolle des Landes geführt. Jakob Kaiser, der Vorsitzende der
CDU in der sowjetischen Besatzungszone (SBZ), entwarf
die Vision eines neutralen Deutschlands, das als „ehrlicher
Makler“ bzw. als „Brücke“ zwischen Ost und West dienen
sollte. Konrad Adenauer, der 1949 zum ersten Kanzler der
Bundesrepublik gewählt wurde, hielt eine Brückenfunk-
tion zwischen Ost und West dagegen für unrealistisch und
gefährlich. Er plädierte für eine enge Westbindung, um
Der sowjetische Premierminister Josef Stalin, US-Präsident Franklin D. Roo-
sevelt und der britische Premierminister Winston Churchill auf der Teheraner
Konferenz, November 1943
Foto: Interfoto/Granger, NYC


















