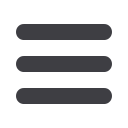

21
Mittler zwischen Ost und West?
Einsichten und Perspektiven 3 | 16
Erst die „Neue Ostpolitik“ unter Kanzler Willy Brandt
setzte ab 1969 neue Akzente. Die Bundesrepublik
befand sich damals mit ihrer Nichtanerkennung der
Nachkriegsrealität im Osten in einer Sackgasse, während
das Machtgleichgewicht zwischen den Blöcken eine Ent-
spannungspolitik erlaubte. Die sozialliberale Koalition
entwickelte in der Situation den Ansatz „Wandel durch
Annäherung“. Er ging davon aus, dass es politische, öko-
nomische und gesellschaftliche Annäherung brauchte,
um Wandel im deutsch-deutschen und im Ost-West-
Verhältnis anzustoßen. Die Regierung Brandt erkannte
die DDR staatsrechtlich an und verhandelte von 1970
bis 1973 mit der Sowjetunion, Polen, der DDR und der
ČSSR die sogenannten Ostverträge. Eingebettet in inter-
nationale Initiativen (1971 Viermächte-Abkommen; ab
1973 Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa KSZE) bemühte sie sich in der Folge um Ver-
netzung, Verständigung und menschliche Erleichterun-
gen. Wirtschaftliche und finanzielle Anreize spielten
dabei eine wichtige Rolle. An ihrer Westbindung ließ die
Bundesrepublik aber keinen Zweifel: Sie versuchte aus
der festen Verankerung im Westen heraus die Beziehun-
gen nach Osten zu gestalten.
Der Prozess der Wiedervereinigung bekräftigte die
Überzeugung, dass es auch künftig keine Schaukelpolitik
geben durfte, aber Interessensvermittlung brauchte. Wäh-
rend die USA verlässlich an der Seite der Bundesrepublik
standen, sorgte man sich in einigen europäischen Haupt-
städten vor einem wiedererstarkenden Deutschland, das
die Machtbalance in Europa zerstören und einen nationa-
len Sonderweg einschlagen könnte. Bundeskanzler Hel-
mut Kohl setzte alles daran, solche Befürchtungen zu zer-
streuen, indem er die deutsche Einheit mit der Vertiefung
der europäischen Integration verknüpfte. Zugleich war
der Verbleib Deutschlands in der NATO für Kohl unver-
zichtbar, um die eigene Sicherheit zu wahren und die west-
lichen Partner zu beruhigen. Die USA, Frankreich und
Großbritannien erachteten die NATO-Mitgliedschaft als
zwingend für die europäische Stabilität. Der sowjetische
Staatschef Michail Gorbatschow stimmte dem Prinzip
der freien Bündniswahl und damit dem Verbleib Gesamt-
deutschlands in der NATO zu, nachdem er anfangs bünd-
nispolitische Neutralität gefordert hatte. Dafür ging Bonn
auf andere Anliegen ein und finanzierte u.a. den bis 1994
gestreckten Abzug sowjetischer Streitkräfte aus der DDR.
Weitere Selbstbeschränkungen, etwa der erneute Verzicht
auf ABC-Waffen und die Begrenzung der Bundeswehr auf
370.000 Mann, rundeten das Paket deutscher Rückversi-
cherungen nach Westen und Osten ab und machten im
Zwei-Plus-Vier-Vertrag von 1990 den Weg frei für die
Wiedervereinigung.
2
Die Bundesrepublik besaß damit einen präzisen außen-
politischen Kompass, der sie weiter leiten würde. Die Ver-
ankerung im Westen und die Weiterentwicklung beste-
hender Institutionen waren aus deutscher Sicht essenziell
für die europäische Friedensordnung. Interessenverflech-
tung, Institutionalisierung und Selbsteinbindung hatten
sich als außenpolitische Instrumente bewährt. Angesichts
seiner Lage an der Schnittstelle zwischen Ost und West
und seiner historischen Verantwortung hatte Deutsch-
land ein besonderes Interesse daran, den Kalten Krieg in
einen positiven Frieden zu überführen. Sein politisches
und wirtschaftliches Gewicht sowie die seit den Tagen der
Neuen Ostpolitik und im Prozess der Wiedervereinigung
kultivierten Beziehungen nach Osten machten es auf dem
Weg dahin zu einem wichtigen Mittler. Eine wertneutrale
„Brücke“ zwischen Ost und West konnte und wollte das
wiedervereinigte Deutschland jedoch nicht sein.
Suche nach einer gesamteuropäischen Friedens
ordnung im westlichen Verbund
Die Chancen für eine gesamteuropäische Friedensord-
nung schienen günstig, weil ein neuer Grundkonsens
von Vancouver bis Wladiwostok in Aussicht stand. Die
NATO und der Warschauer Pakt erklärten im November
1990 ihre Feindschaft für beendet. Die im Rahmen der
blockübergreifenden KSZE im November 1990 formu-
lierte Charta von Paris kündigte „in Europa ein neues
Zeitalter der Demokratie, der Freiheit und der Einheit“
an und versprach ein „unerschütterliches Bekenntnis zu
einer auf Menschenrechten und Grundfreiheiten beru-
henden Demokratie, Wohlstand durch wirtschaftliche
Freiheit und soziale Gerechtigkeit und gleiche Sicher-
heit für alle unsere Länder.“ Zugleich bekräftigten die
Unterzeichner, jeder „gegen die territoriale Integrität
oder politische Unabhängigkeit eines Staates gerichteten
Androhung oder Anwendung von Gewalt“ zu entsagen.
3
Die Sowjetunion und ihre Satelliten verpflichteten sich
damit zu grundlegenden Reformen; zugleich schwor
Moskau Ansprüchen auf Weisungs- oder Interventions-
prärogative in einer eigenen Einflusssphäre ab. Bundes-
präsident Richard von Weizsäcker fasste die damalige
2 Zur bundesrepublikanischen Außenpolitik von den Anfängen bis zur Wie-
dervereinigung vgl. Stephan Bierling: Die Außenpolitik der Bundesrepublik
Deutschland. Normen, Akteure, Entscheidungen,
2
München 2005.
3 Charta von Paris für ein neues Europa, 21.11.1990,
<www.osce.org/node/39518> [Stand: 04.09.2016].


















