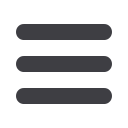

23
Mittler zwischen Ost und West?
Einsichten und Perspektiven 3 | 16
nicht als Jahrzehnt des Aufbruchs in
Erinnerung bleiben.
Aus Bonner Sicht musste „deutsche
Russlandpolitik […] europäische Ost-
politik“ sein, d.h. sie musste multilateral
eingebettet sein und russische und mit-
telosteuropäische Interessen gleicherma-
ßen berücksichtigen.
7
Europäische Ini-
tiativen gegenüber Russland bemühten
sich, Reformprozesse zu unterstützen und
Anknüpfungspunkte zu eröffnen. Dazu
gehörten das 1994 ausgehandelte Part-
nerschafts- und Kooperationsabkommen
zwischen der EU und Russland und die
Gemeinsame Strategie der Europäischen
Union zu Russland von 1999. In beiden
Fällen war die Bundesregierung eine trei-
bende Kraft.
8
Die Reformimpulse, die die
EU für Mittel- und Osteuropa bot, ver-
sprachen derweil auch Vorteile für Russ-
land, das trotz aller Turbulenzen auf dem
Weg zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit
und Marktwirtschaft schien. Einen Kon-
flikt zwischen der europäischen Ost
politik und russischen Interessen gab es
damals nicht.
Heikler erwies sich die Suche nach
einer neuen Sicherheitsordnung. Ungarn
hatte die NATO schon im Februar
1990 – noch vor dem Zerfall des War-
schauer Pakts – mit seinem Beitritts-
wunsch konfrontiert. Auch der tschechoslowakische Präsi-
dent Vaclav Havel hatte bereits im März 1991 gefordert,
dass sich die NATO als freiheitlich-demokratisches Bünd-
nis gleichgesinnten Nachbarn nicht verschließen könne.
9
Die Bundesregierung hoffte zunächst auf eine Rolle für
die paneuropäische KSZE (ab 1995 OSZE). Doch diese
war institutionell nicht hinreichend gerüstet. So wurde die
NATO, die für Westeuropa ohnehin unverzichtbar blieb,
zur Grundlage gesamteuropäischer Sicherheit.
Die NATO sah sich seit 1990/1991 in einer neuen
politischen Rolle bei der Gestaltung einer Friedensord-
7 Katrin Bastian: Die Europäische Union und Russland: Multilaterale und
bilaterale Dimension in der europäischen Außenpolitik, Wiesbaden 2006,
S. 147.
8 Vgl. Bastian (wie Anm. 7), S. 163 f.
9 Vgl. Johannes Varwick: Die NATO. Vom Verteidigungsbündnis zur Welt
polizei?, München 2008, S. 97 f.
nung in Europa.
10
Die Gründung des Nordatlantischen
Kooperationsrats im Dezember 1991 sollte zur Vertrau-
ensbildung zwischen NATO-Mitgliedern, den ehemali-
gen Warschauer Pakt-Staaten und Moskau dienen. Die
Staaten Mittelosteuropas suchten derweil nach Jahrzehn-
ten sowjetischen Zwangs Schutz vor Russland. Schnelle
Beitritte stellte die NATO jedoch nicht Aussicht, weil
sie keinen Bruch mit Russland riskieren wollte, das der
Diskussion ablehnend gegenüberstand. Verteidigungsmi-
nister Volker Rühe untermauerte dies noch 1993, obwohl
er die Osterweiterungsdebatte in der NATO angestoßen
hatte und den Anliegen der mittelosteuropäischen Länder
10 Vgl. NATO: Londoner Erklärung. Die Nordatlantische Allianz im Wandel,
06.07.1990,
<www.nato.diplo.de/contentblob/1940774/Daten/.../1990_07_London_DownlDat.pdf>; NATO: The Alliance’s New Strategic Concept,
07./08.11.1991, <www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_23847.htm>
[Stand: 04.09.2016].
ehem.
DDR
Polen
Russland
Estland
Lettland
Litauen
Weiß-
russland
Ukraine
Mold.
Ungarn
Tschechien*
Slowakei*
Rumänien
Bulgarien
Nach dem Ende des Kalten Krieges sind mehrere Staaten des von der Sowjetunion
angeführten Militärbündnisses Warschauer Pakt der Nato beigetreten. Russland hat
die Annäherung der Nato an seine Grenzen stets kritisiert.
Nato-Erweiterung in Osteuropa
20640
Albanien**
Warschauer Pakt
bis 1991
Nato
vor 1991
Nato-Beitritt
nach 1991
nicht in der Nato
ehemalige Sowjetunion
Nato-Beitritt
nach 1991
**nur bis 1968 im Warschauer Pakt
Quelle: Nato, Bundeszentrale für polit. Bildung
*ehemalige Tschechoslowakei
Abbildung: picture-alliance/dpa-Graphik


















