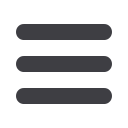
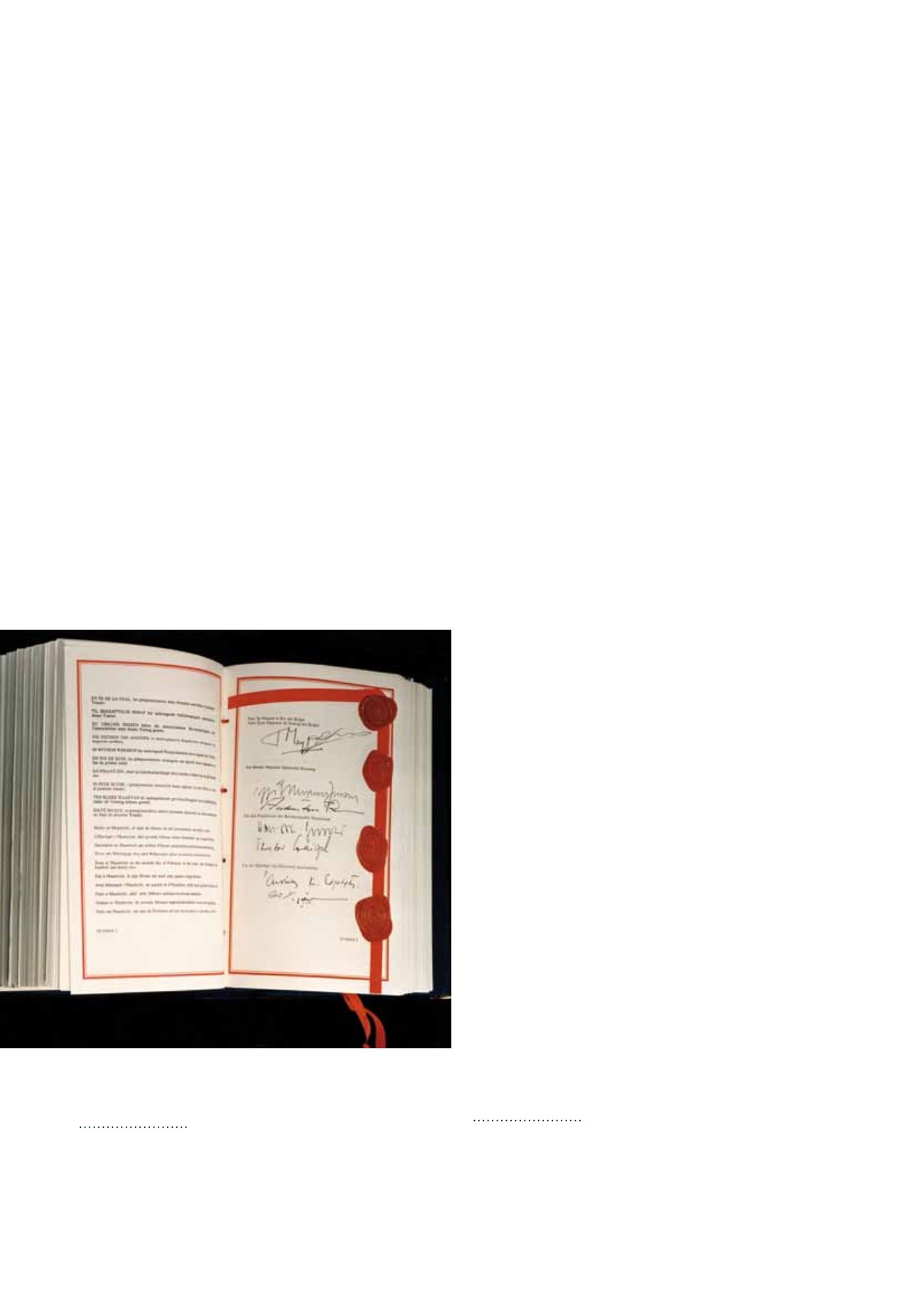
22
Mittler zwischen Ost und West?
Einsichten und Perspektiven 3 | 16
Aufbruchsstimmung zusammen: „Der Kalte Krieg ist
überwunden. Freiheit und Demokratie haben sich bald
in allen Staaten durchgesetzt. Nicht durch Zwang von
Vormächten, sondern aus freien Stücken können sie
nun ihre Beziehungen so verdichten und institutionell
absichern, daß daraus erstmals eine gemeinsame Lebens-
und Friedensordnung werden kann. Für die Völker
Europas beginnt damit ein grundlegend neues Kapitel
in ihrer Geschichte. Sein Ziel ist eine gesamteuropäische
Einigung.“
4
Der Umgang mit den Umbrüchen in Europa blieb
schwierig. Mit der Auflösung des Warschauer Pakts im
Juli 1991 und dem Zerfall der Sowjetunion im Dezember
1991 änderten sich auf östlicher Seite die institutionel-
len Rahmenbedingungen grundlegend. Welchen Ausgang
die Transformationsprozesse nehmen würden, war nicht
abzusehen. Aus westlicher Sicht war klar, dass es politische,
ökonomische und institutionelle Angebote brauchte, um
zur Stabilisierung und Demokratisierung Osteuropas bei-
zutragen. Zugleich mussten nach der deutschen Einheit
und dem Ende der Blockkonfrontation auch im Westen
manche Weichen neu gestellt werden.
4 Richard von Weizsäcker: Ansprache zum Staatsakt am Tag der Deutschen
Einheit, 03.10.1990,
<www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Richard-von-Weizsaecker/Reden/1990/10/19901003_Rede.html> [Stand:
06.09.2016]
Die Weiterentwicklung der europäischen Integration besaß
oberste Priorität. Ihre Vertiefung sollte die deutsche Ein-
heit institutionell absichern und Europa rüsten, falls sich
die USA in Zukunft zurückzögen. Schon die Wiederver-
einigung war mit der Schaffung einer Währungsunion
verknüpft worden. Die Überführung der Europäischen
Gemeinschaft in die Europäische Union und das Bekennt-
nis zu einer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspoli-
tik im Vertrag von Maastricht 1992 waren bedeutende
Wegmarken. Der Vertrag von Amsterdam 1997 begrün-
dete die Europäische Sicherheits- und Verteidigungs
politik und gab der EU ein außenpolitisches Gesicht. Die
Bundesrepublik war – neben Frankreich – eine treibende
Kraft für diese Integrationsschritte, weil sie für die inner
europäische Machtbalance ebenso wichtig waren wie für
die Handlungsfähigkeit nach außen.
Diese starke EU sollte die Umbruchsprozesse in Mit-
tel- und Osteuropa konstruktiv begleiten. Schon 1990
bekundeten mittelosteuropäische Staaten ihren Beitritts-
wunsch und Europa reagierte mit ersten Assoziierungsab-
kommen. Die Offenheit der EU für neue Mitglieder war
im Sinne einer europäischen Einigung folgerichtig, zumal
sie Reformimpulse bot. Deutschland war federführend
beteiligt, als 1994 eine sogenannte Heranführungsstrategie
für potenzielle Beitrittskandidaten im Osten beschlossen
wurde, und vermittelte gegenüber den EU-Mitgliedern, die
Verteilungskonflikte fürchteten. Da Aspiranten eine demo-
kratische, rechtsstaatliche und marktwirtschaftliche Ord-
nung besitzen und den gesamten Regelsatz der EU
(„acquis
communautaire“)
umsetzen mussten, waren schnelle Bei-
tritte nicht zu erwarten. Politische und ökonomische Pers-
pektiven eröffnete die EU aber bereits auf demWeg dahin.
5
UmRussland zu stabilisieren und seine Demokratisierung
zu unterstützen, versuchte die Bundesrepublik, seinen wirt-
schaftlichen Absturz mit Krediten, Bürgschaften und Hilfs-
angeboten abzufedern. Außerdem bemühte sich Deutsch-
land um Moskaus internationale Einbindung. Es setzte sich
für seine Aufnahme in die Weltbank und den Internationa-
len Währungsfonds (IWF) 1992 ein und drängte auf Russ-
landhilfen in Milliardenhöhe. Auf Betreiben Deutschlands
wurde das Land trotz seiner ökonomischen Schwäche in die
G7 aufgenommen, den Bund führender Industrienationen,
der ab 1998 als G8 tagte.
6
Allerdings würden die 1990er
Jahre in Russland dennoch als Jahrzehnt des Niedergangs,
5 Vgl. Gunther Hellmann/Wolfgang Wagner/Rainer Baumann: Deutsche Au-
ßenpolitik. Eine Einführung.
2
Wiesbaden 2014, S. 108–110.
6 Vgl. Stephan Bierling: Vormacht wider Willen. Deutsche Außenpolitik von
der Wiedervereinigung zur Gegenwart, München 2014, S. 60–64.
Der Maastrichter Vertrag über die Europäische Union vom 7. Februar 1992
Foto: ullstein bild - BPA


















