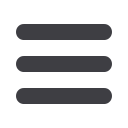

26
Mittler zwischen Ost und West?
Einsichten und Perspektiven 3 | 16
hender Organisationen wie der NATO betonte.
19
Schrö-
der kritisierte wiederum wie Putin die US-Pläne für ein
Raketenabwehrprogramm in Europa.
Die Annäherung an Russland half aber nicht, das Land
an Europa zu binden. Stattdessen schien Berlin wirt-
schaftsgetriebene Interessenpolitik zu betreiben. Schröder
bezeichnete Putin als „lupenreinen Demokraten“ und
überdeckte Moskaus Rückschritte im Demokratisierungs-
und Liberalisierungsprozess. Der 2005 vereinbarte Bau
der North-Stream-Pipeline, die russisches Gas durch die
Ostsee direkt nach Deutschland liefern würde, trug nicht
dazu bei, die russische Repressionspolitik gegen seine
Nachbarn einzuhegen. Als Reaktion auf seinen Einfluss-
verlust impostsowjetischen RaumnutzteMoskau Ressour-
cenexporte nämlich wiederholt – z.B. nach der „Orangen
Revolution“ 2004 in der Ukraine – als politisches Druck-
mittel. Die Direktverbindung koppelte Deutschland von
den Transitstaaten ab. Wie schwer in Osteuropa die Sorge
vor einem deutsch-russischen Schulterschluss wog, zeigte
sich daran, dass Polen das Projekt in der „Tradition des
Ribbentrop-Molotow-Pakts“ sah.
20
19 Vgl. Deutscher Bundestag: Wortprotokoll der Rede Wladimir Putins im Deut-
schen Bundestag, 25.09.2001,
<www.bundestag.de/kulturundgeschichte/geschichte/gastredner/putin/putin_wort/244966> [Stand: 05.09.2016].
20 Vgl. generell Hans-Joachim Spanger: Die deutsche Russlandpolitik, in: Deut-
sche Außenpolitik, hg. v. Thomas Jäger/Alexander Höse/Kai Oppermann,
2
Wiesbaden 2011, S. 648–672; Zitat von Radoslaw Sikorski ebd. S. 648.
In Washington, Brüssel und Osteuropa rief dies ernste
Sorgen hervor. Konsequent zu Ende gedacht stellte sich
nämlich die Frage, ob sich Deutschland außenpolitisch
neu positionierte. Eine ordnungspolitische Alternativkon-
zeption stand jedoch nicht zur Debatte. Avancen Moskaus
für eine neue Sicherheitsarchitektur lehnte Schröder ab:
„Nato, Europäische Union und die Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa bieten einen
ausreichenden Rahmen für die fortschreitende Einbin-
dung Russlands in die europäischen und transatlantischen
Sicherheitsstrukturen.“
21
In der NATO weitete Deutsch-
land sein Engagement sukzessive aus. Auch in der Erwei-
terungspolitik gab es Kontinuität. Deutschland setzte
sich dafür ein, dass Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen,
Rumänien, die Slowakei und Slowenien 2004 in die Atlan-
tische Allianz aufgenommen wurden. Das Bündnis hatte
vor der Entscheidung 2002 mit dem NATO-Russland-
Rat das Verhältnis zu Moskau erneut vertieft; Russland
hatte erklärt, dass die Erweiterungspolitik seine Interessen
nicht gefährdete.
22
Daneben war Deutschland ein enger
Verbündeter der zehn Staaten, die 2004 der EU beitraten:
21 Gerhard Schröder: Deutsche Russlandpolitik – europäische Ostpolitik. Ge-
gen Stereotype, für Partnerschaft und Offenheit – eine Positionsbestim-
mung, in: Die Zeit v. 05.04.2001.
22 Vgl. Gunter Hauser: Der Beitrag der Nato zur europäischen Friedensord-
nung, in: „Gesamteuropäische Friedensordnung 1989–2009“, hg. v. Michael
Staack, Bremen 2010, S. 48–78, hier S. 60.
Bundeskanzler Gerhard Schröder und Präsident Wladimir Putin in Moskau, 9. Mai 2005
Foto: ullstein bild/BPA


















