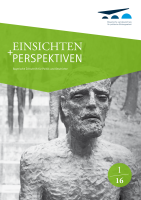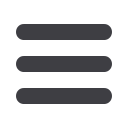

52
Europäische Erinnerungspolitik
Einsichten und Perspektiven 1 | 16
Vom erfolgten Wechsel hin zu einer gleichberechtigen
Erinnerung an die Verbrechen sowohl des Nationalsozi-
alismus als auch des Stalinismus legt auch die konkrete
Ausgestaltung des Bereichs „Europäisches Geschichtsbe-
wusstsein“ im Programm „Europa für Bürgerinnen und
Bürger“ 2014–2020 Zeugnis ab, im Rahmen dessen „Ini-
tiativen gefördert werden [können], die sich mit den Ursa-
chen für die totalitären Regime in der neueren Geschichte
Europas (vor allem, aber nicht ausschließlich National-
sozialismus, der zum Holocaust geführt hat, Faschismus,
Stalinismus und totalitäre kommunistische Regime) und
dem Gedenken an die Opfer beschäftigen“.
36
Der nach der Osterweiterung erkennbar gewordene Per-
spektivenwechsel indes war und blieb im Kern bis heute
umstritten. Unterschiedliche Bewertungen der Erweiterung
des Fokus eines europäischen historischen Gedächtnisses,
das Stalinismus und Kommunismus explizit miteinbezieht,
werden nicht nur entlang des politischen Links-Rechts-
Spektrums, sondern auch zwischen westlichen und östli-
chen EU-Mitgliedstaaten deutlich. So kann die im Westen
verbreitete Interpretation des Zweiten Weltkriegs als einem
unter dem Banner der Freiheit und der Demokratie gegen
Faschismus und Nationalsozialismus geführten Krieg von
osteuropäischen Ländern nicht oder nur sehr eingeschränkt
geteilt werden: 1945 mag zwar die Befreiung vom Natio-
nalsozialismus markieren, steht gleichzeitig aber für den
Beginn neuer – namentlich sowjetischer – Fremdherrschaft
36 Rat 2014 (wie Anm. 32), Anhang.
und die Schaffung diktatorischer Regime. Umgekehrt blei-
ben angesichts des Fehlens vergleichbarer Erfahrungen mit
kommunistischer Herrschaft in den alten EU-Mitgliedstaa-
ten Nationalsozialismus und Holocaust bis heute prägend
für deren Erinnerungskulturen.
Dementsprechend erscheint die auf EU-Ebene bemühte
Formel von „Nationalsozialismus und Stalinismus als gleich-
wertige Übel“ letztlich weniger als Ausdruck eines gemein-
samen Bezugspunktes transeuropäischen historischen Erin-
nerns, denn vielmehr Umschreibung einer fortdauernden,
teilweise rivalisierenden Parallelität unterschiedlicher Erin-
nerungsrahmen.
Forcierung eines teleologisch-reduktionistischen Geschichts-
verständnisses
Die Bestimmung von Nationalsozialismus und Stalinismus
als Hauptbezugspunkte für ein kollektives europäisches
Gedächtnis ist einerseits nachvollziehbar, stellen die Tota-
litarismen des 20. Jahrhunderts doch einen klaren Kont-
rast zu den im „europäischen Projekt“ verkörperten Idealen
dar: Frieden, Freiheit und Demokratie, Rechtsstaatlichkeit,
Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten, oder das Recht
auf individuelle Selbstbestimmung und Pluralismus. Ande-
rerseits ist dies insofern problematisch, als eine Sicht der
Geschichte forciert wird, die Europas „dunkle Vergangen-
heit“ als Antipode seiner „glänzenden Gegenwart“ erschei-
nen lässt. Indem das heutige Europa als eine Art „vollen-
deter historischer Vernunft“ anmutet – gewissermaßen ein
Kontinent nobler Traditionen, Institutionen und Prinzi-
pien – wird ein eindimensionales Geschichtsverständnis
befördert, das der Schaffung einer kritischen europäischen
Öffentlichkeit abträglich ist. Nicht durch die Idealisie-
rung des europäischen Integrationsprozesses seit den spä-
ten 1940er Jahren, sondern allein durch (selbst-)kritische
Hinterfragung des weitverbreiteten Topos einer „fortgesetz-
ten Erfolgsgeschichte“ kann eine fruchtbare Debatte über
zukünftige Verbesserungen sinnvoll angestoßen werden.
Zudem erweist sich der Fokus auf Nationalsozialismus
und Stalinismus insofern problematisch, als er europäische
Geschichte im Wesentlichen zu einem Phänomen der Zeit
nach dem Ersten Weltkrieg macht. Dadurch wird nicht nur
historische Komplexität auf unzulässige Weise reduziert,
auch bleiben andere Epochen und fundamentale historische
Erfahrungen außen vor, die für das Verständnis des zeitge-
nössischen Europa essentiell sind. So lässt sich etwa das Pro-
blem des radikalen Nationalismus nur schwerlich ohne das
18. und 19. Jahrhundert verstehen, und erscheint die Erfah-
rung von Kolonialismus und Imperialismus nicht weniger
„europäisch“ als jene von Totalitarismus – gerade, wenn
In Prag erinnert ein Denkmal an die Opfer des Kommunismus: Figuren tauchen
aus dem Nichts auf einer Treppe auf und verlieren sich wieder.
Foto: ullstein bild-Westend61/Fotograf: Valentin Weinhäupl