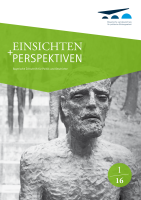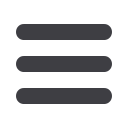

47
Europäische Erinnerungspolitik
Einsichten und Perspektiven 1 | 16
II. Beförderung eines gemeinsamen europäischen Gedächt-
nisses basierend auf weit gefassten Topoi wie zum Bei-
spiel „Demokratie“ oder „Freiheit“ und einem tenden-
ziell unverbindlichen Charakter;
III. Forcierung eines kollektiven europäischen Gedächt-
nisses auf der Grundlage klar definierter historischer
Wegmarken und entsprechender Verbindlichkeit.
Letzteres steht im Mittelpunkt jüngerer politischer Initia-
tiven in Europa. Versuche, bestehende nationale kollektive
Identitäten und Erinnerungen durch eine transnationale
Komponente zu ergänzen, um dem europäischen Projekt
zusätzliche Legitimität zu verleihen, wurden seitens der
politischen Eliten seit den Anfängen der europäischen
Integration unternommen. Doch während europäisches
„(Kultur-)Erbe“ imweitesten Sinne,
7
der ZweiteWeltkrieg
7 Siehe beispielsweise das „Dokument über die europäische Identität“, das
am 14. Dezember 1973 auf dem Gipfel von Kopenhagen von den europä-
ischen Staats- und Regierungschefs angenommen wurde. In: Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften, Dezember 1973, Nr. 12, S. 118–122.
Zu jüngeren europäischen Maßnahmen in diese Richtung zählt das „Eu-
ropäische Kulturerbe-Siegel“, und auch die Initiative „Kulturhauptstadt
Europas“ nimmt die Idee eines bestehenden gemeinsamen, wenn auch
verschiedenartigen europäischen Erbes auf.
als Initialzündung der europäischen Integration
8
und die
Errungenschaften der Integration selbst als traditionelle
Referenzpunkte dienten, hat sich in den vergangenen zwei
Jahrzehnten ein konkreterer Fokus herausgebildet, der die
spezifische Erinnerung an den Holocaust einerseits, die
totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts – insbesondere
Nationalsozialismus und Stalinismus – andererseits in den
Mittelpunkt gedächtnispolitischer Bemühungen stellt.
Ihren Ausdruck finden diese gedächtnispolitischen
Bemühungen in verschiedenen bewusstseinsbildenden
Initiativen seit den 1990er Jahren, vor allem durch das
Europäische Parlament. So gab das Europäische Parla-
ment nach vorangegangenen Entschließungen über Ras-
sismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus
9
und
im Gefolge der Erklärung des Internationalen Forums von
Stockholm über den Holocaust (26.–28. Januar 2000)
10
im Juli 2000 etwa eine Erklärung zur Erinnerung an den
8 Siehe hierzu etwa die Schuman-Erklärung vom 9. Mai 1950. Die Erklä-
rung selbst folgte auf eine lange zurückreichende Denktradition, die für
eine europäische (Kon-)Föderation zur Überwindung von Nationalismus
argumentierte. Vgl. auch Winston Churchills vielzitierte Forderung nach
Schaffung der „Vereinigten Staaten von Europa“ in einer Rede an der Uni-
versität Zürich am 19. September 1946.
9 Siehe insbesondere: „Entschließung des Europäischen Parlaments zu Ras-
sismus und Ausländerfeindlichkeit, 27. Oktober 1994“, in: Amtsblatt der
Europäischen Union C 323 vom 21.11.1994, S. 154ff.; „Entschließung des
Europäischen Parlaments zu Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Anti-
semitismus, 27. April 1995“, in: Amtsblatt der Europäischen Union C 126
vom 22.05.1995, S. 75ff.; „Entschließung des Europäischen Parlaments zu
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus, 27. Oktober 1995“,
in: Amtsblatt der Europäischen Union C 308 vom 20.11.1995, S. 140–142;
„Entschließung des Europäischen Parlaments zu Rassismus, Fremden-
feindlichkeit und Antisemitismus und zum Europäischen Jahr gegen
Rassismus, 30. Januar 1997“, in: Amtsblatt der Europäischen Union C 55
vom 24.02.1997, S. 17–22; „Entschließung des Europäischen Parlaments
zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in der Europä-
ischen Union, 29. Dezember 2000“, in: Amtsblatt der Europäischen Union
C 377 vom 29.12.2000, S. 366–375.
10 Während des Stockholmer Internationalen Holocaust-Forums (
Stockholm
International Forum on the Holocaust
) wurde eine gemeinsame Erklärung
angenommen, die als Gründungsdokument der
Task Force for Internati-
onal Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research
(ITF) – seit Januar 2013
International Holocaust Remembrance Alliance
(IHRA) – als intergouvernementaler Organisation diente. Die Erklärung
betonte die Wichtigkeit, „die schreckliche Wahrheit über den Holocaust
gegenüber denjenigen, die ihn verleugnen“, zu bewahren (Artikel 3) und
die Erinnerung an den Holocaust als einen „Prüfstein unseres Verständ-
nisses der Fähigkeit des Menschen zu guten und bösen Taten“ (Artikel 2)
wachzuhalten. Die Erklärung forderte mehr Unterricht und Bildung in
Sachen Holocaust (Artikel 5), und brachte die Verpflichtung ihrer Unter-
zeichner zum Ausdruck, den „Opfern des Holocaust zu gedenken und jene
zu ehren, die sich gegen ihn gestellt haben“, sowie „in unseren Ländern
geeignete Formen der Erinnerung an den Holocaust, einschließlich eines
jährlichen Tags der Erinnerung an den Holocaust, zu unterstützen“ (Arti-
kel 6). Die Erklärung ist auf der Website der IHRA zu finden: http://www.
holocaustremembrance.com/about-us/stockholm-declaration.Titelseite des Dekrets der französischen Nationalversammlung mit der Erklä-
rung der Menschenrechte, 3. September 1791
Abbildung: ullstein bild