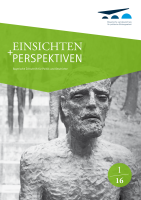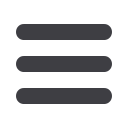

42
Władysław Bartoszewski, der Brückenbauer
Einsichten und Perspektiven 1 | 16
Deutsch–polnischer Dialog
Um das Verbindende zu finden muss man sich kennen,
mehr voneinander wissen, sich nicht von Vorurteilen leiten
lassen. Bald nach seiner Entlassung aus dem stalinistischen
Gefängnis im August 1954 stieß Bartoszewski auf weitere
Informationen über die Geschwister Scholl, die „Weiße
Rose“ und Bischof Graf Galen. Dies führte zu Reflexionen
über den zerstörerischen Einfluss von Totalitarismen auf
das Schicksal des Einzelnen. Bartoszewski überlegte, dass
Hans Scholl, nicht viel älter als er, während seines Wehr-
machtdienstes in Polen in Warschau gewesen und sie sich
auf der Straße begegnet sein könnten. Trotz einer – wie
wir heute wissen – ähnlichen geistigen Einstellung wäre
es nicht möglich gewesen ins Gespräch zu kommen. Zwi-
schen beiden klaffte ein Abgrund. Ein Abgrund, der stets
Begleitelement einer Diktatur und eines Totalitarismus ist.
Menschen werden zu Schachfiguren, die ihrer Individuali-
tät beraubt werden sollen.
22
Solche Überlegungen bestärk-
ten in Bartoszewski die Auffassung, dass Dialog ungeheuer
wichtig sei. Ähnliche Einstellungen fand er in der Redak-
tion des
Tygodnik Powszechny
, der er seit 1957 angehörte.
Während des sogenannten „Tauwetters“ 1956 kam es
auch in Polen
zu einer gewissen politischen Lockerung.
Es entstanden die „Clubs der Katholischen Intelligenz“
und nach dreijähriger Zwangspause durfte die katholisch-
liberale
Tygodnik Powszechny
wieder erscheinen. Hier
sammelten sich Menschen, die eine Alternative und eine
intellektuelle Nische suchten gegen das staatlich diktierte
Denkmodell. Von daher zeichnete sich die Gruppe um
Tygodnik Powszechny
durch große Offenheit aus. Ver-
ständlicherweise war die Redaktion deshalb Anlaufstelle
für vorsichtige informelle Gespräche mit Deutschen. Die
ersten Kontakte bestanden mit Vertretern der „Aktion Süh-
nezeichen“. Es folgten Begegnungen mit Mitgliedern der
Deutschen Sektion von „Pax Christi“ und des Maximilian-
Kolbe-Werkes. Um die deutschen Gäste kümmerte sich
meistens Bartoszewski und konnte so nicht nur diverse
Kontakte knüpfen, sondern auch Einblick gewinnen in die
herrschende Stimmungslage in Deutschland. Die sechzi-
ger Jahre sind eine Zeit des Anstoßes reger Aktivitäten in
den deutsch-polnischen Beziehungen, insbesondere durch
die Denkschrift der EKD vom 1. Oktober 1965 und
den Briefwechsel der polnischen und deutschen Bischöfe
vom 18. November und 5. Dezember 1965 am Ende des
II. Vatikanischen Konzils. Da aber das Reisen ins westliche
22 Władysław Bartoszewski: 0 Niemcach i Polakach. Wspomnienia. Prognozy.
Nadzieje (Über Deutsche und Polen. Erinnerungen. Prognosen. Hoffnun-
gen), hg. v. Rafał Rogulski u. Jan Rydel, Kraków 2010, S. 36 f.
Ausland für Bürger der Volkrepublik Polen nur erschwert
möglich war, konnte Bartoszewski erst im Mai 1965
Deutschland zum ersten Mal besuchen. Er reiste auf Ein-
ladung der Zeitschrift „Dokumente“ an, die sich haupt-
sächlich mit deutsch-französischen Themen im europäi-
schen Kontext beschäftigte – also eine für die polnischen
Passbehörden genügend unverfängliche Einladung, sodass
die Reise genehmigt wurde. In den Jahren 1969, 1975 und
1976 folgten weitere Reisen nach Deutschland und in den
achtziger Jahren mehrere längere Aufenthalte als Gastpro-
fessor an bayerischen Hochschulen. Bartoszewski nutzte
diese Reisen zu intensiven Gesprächen und vielen Begeg-
nungen, hielt Vorträge und nahm an Diskussionen, auch
mit Schülerinnen und Schülern, teil. Dabei war ihm stets
der Gedankenaustausch wichtig, um einander näher zu
kommen. Seine Beschäftigung mit der neuesten Geschichte
war nicht Selbstzweck, sondern auf die Zukunft ausgerich-
tet. Die Kenntnis der Geschichte soll uns vor Rückfällen
in Hass und Barbarei bewahren, soll uns deutlich machen,
wie brüchig und gefährdet die moderne Zivilisation ist, in
der Freiheit und friedliches Zusammenleben der Menschen
nicht selbstverständlich sind, sondern stets aufs Neue erar-
beitet werden müssen. Dieser auf die Zukunft hin gerich-
tete Blick ist vielleicht der Grund, weshalb ihm die Arbeit
mit Studenten in Lublin und vor allem auch in Bayern so
viel Freude bereitete.
Diesen historisch geschulten Blick auf die Zukunft
konnte Bartoszewski in ganz anderer Form zur Anwendung
bringen, als er nach dem Zusammenbruch des kommunis-
tischen Systems in Polen 1989 politische Ämter übernahm.
Ein wichtiger Moment war, als Bartoszewski als Außen-
minister der Republik Polen in Bonn am 28. April 1995
während der Sondersitzung von Bundestag und Bundesrat
anlässlich des 50. Jahrestages des Kriegsendes eine vielbe-
achtete Rede hielt. Er bezog sich dabei auf die zehn Jahre
zurückliegende, wegweisende Rede Richard von Weizsä-
ckers vom 7. Mai 1985. In seinem historischen Exkurs
ging Bartoszewski auch auf das schmerzliche Thema des
Heimatverlustes ein. Er sagte: „Während des Krieges und
nach seiner Beendigung mussten Millionen von Men-
schen ihre Heimat verlassen. Für viele Polen waren dies
Gebiete jenseits des Bug und für viele Deutsche östlich
von Oder und Neiße. […] Ich möchte es offen ausspre-
chen, wir beklagen das individuelle Schicksal und die Lei-
den von unschuldigen Deutschen, die von den Kriegsfol-
gen betroffen wurden und ihre Heimat verloren haben.“
23
23 Bartoszewski (wie Anm. 2), S. 163 f.