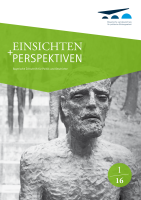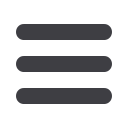

53
Europäische Erinnerungspolitik
Einsichten und Perspektiven 1 | 16
man bedenkt, dass Kolonialismus und Imperialismus sowie
ihre Folgen für die Geschichte und vielfach auch Gegenwart
praktisch aller europäischen Länder und Nationen prägend
waren: sei es, dass sie selbst als Kolonial- oder Imperialmacht
auftraten, sei es, dass sie unter der hegemonialen Fremdherr-
schaft einer anderen (europäischen) Macht standen.
Fehlende Anreize zur kritischen Aufarbeitung von
Geschichte auf nationalstaatlicher Ebene
Die Reduktion von historischem Gedächtnis auf Natio-
nalsozialismus und Stalinismus, die zu einem „negativen
Gründungsmythos“ der EU erhoben werden, birgt dar-
über hinaus die Gefahr, Anreize zur kritischen Hinterfra-
gung von Stereotypen und „heiligen Kühen“ nationaler
Geschichte zu mindern und Debatten um gemeinsame
europäische Verantwortung für die Vergangenheit in den
Hintergrund zu drängen. „Vergangenheitsbewältigung“
auf supranationaler Ebene impliziert auch die Frage nach
gemeinsamer Verantwortung für die Geschichte. Selbstre-
dend ist es einfacher, eine europäische Dimension erken-
nen zu wollen, wenn auf positive Aspekte eines argumen-
tierten europäischen Erbes abgehoben wird, zum Beispiel
die Aufklärung. Doch wenn man unterstellt, dass die Auf-
klärung weniger ein speziell französisches, englisches oder
deutsches, sondern vielmehr ein europäisches Erbe ist,
sind dann nicht in gewissem Sinne auch die Weltkriege,
die Shoah oder die Gulags europäisch?
Auch wenn Verantwortlichkeit niemals zu gleichen Tei-
len zugewiesen werden kann und darf, so scheinen dennoch
ein kritischerer Ansatz und ein inklusiveres Verständnis von
Verantwortung für die Vergangenheit, die den Nationalsozi-
alismus nicht als ausschließlich deutsches, die Gulags nicht
als allein sowjetisches Problem begreifen, und etwa nationale
Legenden von heroischem Widerstand gegen Totalitarismus
nicht unhinterfragt akzeptieren, zwingend nötig. Im wissen-
schaftlich-akademischen Bereich wurde bereits Erhebliches
geleistet, gemeinsame europäische Verantwortung für histori-
sche Errungenschaften wie historisches Versagen aufzuzeigen.
Auf den Ebenen der Politik und des öffentlichen Diskurses
jedoch scheint der Reiz klarer Schwarz-Weiß-Schemata allzu
verlockend, um in absehbarer Zeit an Bedeutung zu ver-
lieren: Sie erlauben es, mit Verweis auf vermeintliche oder
tatsächliche Schuld und historische Verfehlungen anderer
(politisches) Kapital zu schlagen und sich zugleich kritischen
Fragen nach der eigenen Vergangenheit zu entziehen.
Die weithin verbreitete Verknüpfung von historischem
Gedächtnis und Moralität, so lässt sich konstatieren,
erweist sich als höchst gefährliches Unterfangen, das,
anstatt zu einer Aufarbeitung der Vergangenheit beizu-
tragen, den Nährboden für neue Konflikte schafft. Doch
welchen Beitrag kann die europäische Ebene eingedenk
des bislang Skizzierten realistischerweise zur Überwin-
dung von Nationalisierung und politischer Instrumenta-
lisierung von Erinnerung leisten? Dies führt zu einigen
abschließenden Überlegungen zur möglichen zukünftigen
Ausgestaltung europäischer Erinnerungspolitik.
Perspektiven transeuropäischer Erinnerungspolitik
Zusammenfassend lassen sich die bestehenden gedächtnis-
und erinnerungspolitischen Initiativen der EU als durch-
aus ambitioniert und aktiv beschreiben, sie sind zugleich
jedoch durch sehr spezifische historische Referenzen cha-
rakterisiert und verfolgen ein kaum verhülltes politisches
Kalkül von Selbstlegitimierung und europäischer Identi-
tätsbildung. So wie allen Versuchen, historisches Gedächt-
nis zu kollektivieren, sind auch und im Besonderen euro-
päischen Bestrebungen in diese Richtung klare Grenzen
gesetzt. Es erweist sich als schwierig, die Pluralität von
bestehenden Erinnerungskulturen – nationalen, aber auch
regionalen – auf übergeordneter Ebene auf einen gemein-
samen Nenner zu bringen. Hinzu kommt die Divergenz
zwischen fixen und mit einer quasi-universalen Deutung
versehenen historischen Bezugspunkten wie dem Holo-
caust einerseits, den sich aus dem Wechsel der Generatio-
nen notwendig ergebenden Änderungen von historischem
Bewusstsein und Prioritäten der Erinnerung andererseits.
Vor diesem Hintergrund sind Versuche, ein statisches
Rom, 25. März 1957: Bundeskanzler Konrad Adenauer (5.v.l.) und Walter
Hallstein, Staatssekretär im Bundeskanzleramt (6.v.l.), im Rathaus der
italienischen Hauptstadt bei der Unterzeichnung der Römischen Verträge
über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die Europäische
Atomgemeinschaft (EURATOM). Weitere Mitglieder waren Frankreich, Italien
und die Benelux-Staaten.
Foto: ullstein bild