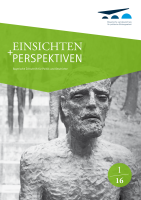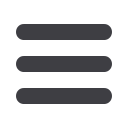

55
Europäische Erinnerungspolitik
Einsichten und Perspektiven 1 | 16
so scheint der potentielle Schaden den Nutzen doch
nicht aufwiegen zu können. Vielversprechender scheint
die Schaffung beziehungsweise Stärkung einer kritischen
Öffentlichkeit vermittels einer Bildungspolitik, die mit
der genannten „Kultur des Erinnerns“ korrespondiert –
eine Kultur, die den Bürgerinnen und Bürgern in Europa
nicht aufgezwungen werden kann, sondern persönlicher
Einsicht und persönlichem Verständnis entspringen muss.
Zentrale Aufgaben einer solchen Bildungspolitik sind:
•
Sensibilisierung von Schülerinnen und Schülern sowie
Studierenden für europäische Vielfalt in Vergangenheit
und Gegenwart;
•
Schaffung der Voraussetzungen, um die Geschichte
des eigenen Landes möglichst objektiv und in weiteren
Kontexten – europäisch wie global – thematisieren zu
können;
•
Ermutigung junger EuropäerInnen, sich aktiv an Diskus-
sionen über Geschichte zu beteiligen und Geschichtsbe-
wusstsein zu schärfen.
Zu diesem Zweck gilt es einen doppelten Schwerpunkt zu
setzen, namentlich:
I. bestehende Lehrpläne und Unterrichtsdidaktik derge-
stalt anzupassen, dass man sich von bislang dominie-
renden nationalgeschichtlichen Ansätzen zugunsten
einer stärker europäischen und globalen Annäherung an
Geschichte löst, und es jungen Europäern ermöglicht,
durch offene und diskursive Lehrformate ein selbstkri-
tisches historisches Bewusstsein zu entwickeln;
43
und
II. eine maßgeschneiderte (Geschichts-)Lehrerausbildung
zu bieten, die diesen Erfordernissen entspricht.
Weder aufgrund der bestehenden Kompetenzlage in der
EU noch aus praktischen Gründen kann die Union die
Aufarbeitung der Vergangenheit für ihre Mitgliedstaa-
ten übernehmen und die nötigen bildungspolitischen
Akzente zu setzen. Doch sie ist in der Lage, nationale
Anstrengungen in dieser Hinsicht sowohl zu fördern als
auch zu fordern – und zugleich eine gemeinsame „Kultur
des Erinnerns“ zu forcieren. Damit bestünde ein Ansatz,
der der Vielfältigkeit bestehender Formen des historischen
Gedächtnisses in Europa Genüge täte, während gleich-
zeitig ein Anreiz geschaffen wäre, diese mit Hilfe eines
gemeinsamen transnationalen Ansatzes neu zu betrachten
und gegebenenfalls auch zu hinterfragen.
43 Eine vielversprechende Initiative dahingehend sind bestehende Pilotpro-
jekte für bi- beziehungsweise multilaterale Geschichtslehrbücher.
Zu diesem Zweck kann die Europäische Union nicht nur
ihr Repertoire an „sanften Machtmitteln“ einsetzen, um
die Mitgliedstaaten zu Engagement zu bewegen, sondern
auch auf bestehende europäische Programme zurückgrei-
fen. Dazu gehören das bereits genannte Programm
Europa
für Bürgerinnen und Bürger
, das die Finanzierung multina-
tionaler Geschichts- und Erinnerungsprojekte ermöglicht,
ebenso wie das Programm „Erasmus+“, mit dem länder-
übergreifende Austauschprogramme und Studienaufent-
halte für Schülerinnen und Schüler, Studierende und Leh-
rende unterstützt werden.
Langfristig wünschenswert wäre die Entwicklung eines
tatsächlich europäischen Diskurses über die Vergangen-
heit des Kontinents, dies auf der Grundlage einer von der
EU begleiteten kritischen Selbstreflexion über Geschichte
und geschichtliche Verantwortung auf nationaler Ebene.
In einen solchen Diskurs würden verschiedene kollektive
Erinnerungen einfließen und sich zu einem gesamteuro-
päischen öffentlichen Raum verbinden – einem Raum, in
dem Erinnerungskulturen einander ergänzen und nicht
miteinander im Wettbewerb stehen und in dem histori-
sches Gedächtnis zuvorderst eine Frage zivilgesellschaftli-
chen und nicht politischen Handelns ist.
Das zentrale musikalische Identifikationsobjekt der Europäischen Union:
Beethovens neunte Sinfonie (Op. 125), hier ein Blatt der Originalpartitur
Foto: ullstein bild – Granger NYC