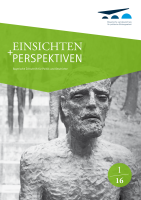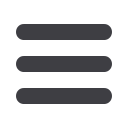

54
Europäische Erinnerungspolitik
Einsichten und Perspektiven 1 | 16
historisches Gedächtnis quasi von oben zu oktroyieren,
letztlich zum Scheitern verurteilt. Gewiss ist: Eine Erinne-
rungskultur, die keine hinreichende Verknüpfung zwischen
der individuellen Erfahrung von Bürgerinnen und Bürgern
einerseits und einer offiziellen Auslegung durch die Politik
andererseits garantiert, kann nicht von Dauer sein. Nicht
zuletzt an dieser zentralen Erkenntnis gilt es künftige poli-
tische Aktivitäten auf europäischer Ebene auszurichten.
Das Ziel von europäischer Erinnerungspolitik sollte die
Entstehung eines informierten und belastbaren, aber auch
selbstkritischen historischen Gedächtnisses sein. Hierfür
scheint die Abwendung von der Idee einer fest definier-
ten „Gedächtniskultur“ hin zu einer gemeinsamen, als
prozesshaft und dynamisch zu verstehenden „Kultur
des
Erinnerns“ vielversprechend und notwendig.
Dabei ginge es zentral darum, von europäischer Seite
aktives Engagement aller Nationalstaaten zu befördern,
ihre je eigene Vergangenheit zu „bewältigen“, oder besser
„aufzuarbeiten“ – ein Begriff, der passender scheint für die
Beschreibung eines möglichst offenen Prozesses von gesell-
schaftlicher und politischer Arbeit an der Vergangenheit,
nicht einer endgültigen Deutung der Vergangenheit.
37
Die Grundlage hierfür könnten gemeinsame europäische
Werte und universalisierte Praktiken der Geschichtsauf-
arbeitung bilden. Anders ausgedrückt: Es ginge um keine
homogenisierende Europäisierung der Inhalte unterschied-
licher kollektiver Erinnerungen, sondern vielmehr um
eine Europäisierung von Einstellungen und Praktiken im
Umgang mit höchst unterschiedlichen Vergangenheiten.
38
Gemeinsame europäische Werte, auf denen ein solches
Unterfangen aufbauen könnte, sind Menschenwürde, Tole-
ranz, Freiheit und Gleichheit, Solidarität und Demokratie;
mit anderen Worten, das bereits bestehende Repertoire von
Grundwerten, das sich als Kern der europäischen Integra-
tion herausgebildet hat und auch entsprechenden rechtli-
chen Niederschlag gefunden hat.
39
Im Einklang mit diesen
37 Das Konzept „Aufarbeitung der Vergangenheit“ wurde vom deutschen So-
ziologen und Philosophen Theodor W. Adorno bereits in den 1950er Jah-
ren geprägt, konkret im Zusammenhang mit Debatten über fortwirkende
nationalsozialistische Einstellungen in der deutschen Bevölkerung. Siehe
insbesondere seinen Essay
The Meaning of Working through the Past
von
1959 (abgedruckt u.a. in Theodor W. Adorno: Critical Models: Interven-
tions and Catchwords. New York, NY 1998, S. 89–103).
38 Jan-Werner Müller: „On ‚European Memory’: Some Conceptual and Nor-
mative Remarks“, in: A European Memory? Contested Histories and Politics
of Remembrance, hg. von Małgorzata Pakier und Bo Stråth, Oxford 2010,
S. 25–37.
39 Diese Grundprinzipien der EU sind unter anderem in der Präambel der
Charta der Grundrechte der Europäischen Union
dargelegt. In: Amtsblatt
der Europäischen Union C 326 vom 26.10.2012, S. 391–407.
Werten stünde im Rahmen der angestrebten „Kultur des
Erinnerns“ die Schaffung von offenen Diskussionsforen
und die Entwicklung eines wechselseitigen Verständnis-
ses, das bi- und multilaterale Aussöhnung erst ermöglicht,
im Zentrum der Bemühungen. Ein derartiger Zugang
impliziert nicht nur die Zurückweisung von Versuchen,
Schuld und Leid zu quantifizieren und zu reihen oder
ein Verbrechen gegen ein anderes aufzurechnen, sondern
auch, schwierige Momente der eigenen Geschichte ohne
Vorbehalte zu thematisieren. Vielversprechende Schritte
in diese Richtung wurden bereits unternommen, etwa in
Gestalt jener „Politik des Bedauerns“ in Europa und dar-
über hinaus, im Kontext derer politische Führer öffentlich
Verantwortung für frühere Vergehen ihres jeweiligen Lan-
des übernehmen und Abbitte zu leisten versuchen.
40
Das Ziel eines unvoreingenommenen Umgangs mit
Geschichte verlangt letzten Endes auch die Abkehr von
„historischer Wahrheit“ als einer absolut verstandenen
Kategorie. Selbst in den Naturwissenschaften lässt sich
nur nach einer „immer stärkeren Annäherung an die
Wahrheit“ streben,
41
und dies gilt in noch stärkerem
Maße für die Geisteswissenschaften. Es mag historische
Fakten geben, aber es gibt keine alleinige oder feststehende
historische Wahrheit, zumal Wahrheit immer in Macht-
strukturen eingebettet bleibt, gleichzeitig einen Teil die-
ser Machtstrukturen bildet und im Laufe der Geschichte
ständigen Veränderungen unterworfen ist.
42
Was heute als
„Wahrheit“ angesehen wird, mag in der Zukunft durch-
aus als „Unwahrheit“ gelten, zugleich ist die Wahrheit des
einen nicht notwendigerweise auch jene eines anderen.
Vor diesem Hintergrund erscheint die autoritativ erfol-
gende Bestimmung
der
historischen Wahrheit ein vergeb-
liches und gefährliches Unterfangen, da jeder derartige
Versuch zwangsläufig polarisierend wirkt und mehr Pro-
bleme schafft, als er zu lösen vermag.
Entsprechend gilt es, die potentiellen Gefahren jedwe-
der geschichtspolitischen Initiative zu erkennen, die auf
eine gesetzgeberische Regelung von Vergangenheit und
die Erinnerung daran zielt: Selbst wenn dahingehende
Rechtsakte von den edelsten Motiven geleitet sein mögen,
40 Beispielhaft für die „Politik des Bedauerns“, nicht zuletzt für die ihr inne-
wohnende Symbolik, war der Kniefall von Warschau des deutschen Bun-
deskanzlers Willy Brandt im Jahr 1970 als Geste der Demut und der Ent-
schuldigung gegenüber den Opfern des Aufstands im Warschauer Ghetto
von 1943.
41 Erich Fromm: Man from Himself: An Inquiry into the Psychology of Ethics.
London 1999 (Original 1947), S. 239.
42 Michel Foucault: The Order of Things: An Archaeology of the Human Sci-
ences, London 1970.