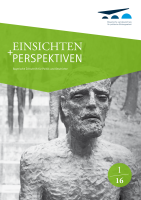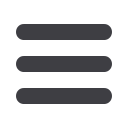

60
Der „Emigrantenstein“ von 1796: steinernes Zeugnis europäischer Geschichte
Einsichten und Perspektiven 1 | 16
Die im Jahr 2000 publizierte Studie von Thomas Höpel,
„Emigranten der Französischen Revolution in Preußen
1789–1806“, die einen wesentlichen Beitrag zur Erfor-
schung der Emigration in Deutschland darstellt, verdeut-
licht den zeithistorischen Hintergrund des Steins.
3
Dort
wird aufgezeigt, dass die heutige Problematik im politisch-
administrativen und sozio-kulturellen Umgang auch in der
Vergangenheit nicht unbekannt war. Auch an der Wende
vom 18. zum 19. Jahrhundert waren Staaten mit einer gro-
ßen Zahl von Flüchtlingen konfrontiert, wie das Beispiel
zeigt. Höpel dokumentiert, dass bereits seinerzeit ein Span-
nungsverhältnis zwischen restriktiven und liberalen Rege-
lungen bestanden habe, und arbeitet die regionalen Unter-
schiede in der Wahrnehmung von Emigranten durch die
einheimische Bevölkerung sowie die Probleme der gesell-
schaftlichen Integration bzw. auch den Einfluss der Emi-
gration auf den Kultur- und Technologietransfer heraus.
Die Inschrift des „Emigrantensteins“ attestiert dem preu-
ßischen König Friedrich Wilhelm II. und seinem Minister
Hardenberg beispielhafte „Menschenliebe, Wohlthätigkeit
und Edelmuth“ gegenüber den französischen Emigranten.
Der Autor weist an Hand der Primärquellen nach, dass
diese Dankbarkeit einen realen Hintergrund hatte. Auf
der Grundlage des königlich-preußischen Reskripts von
1792 verfolgte Hardenberg in seinem fränkischen Zustän-
digkeitsbereich eine besonders emigrantenfreundliche
Politik. Französischen Emigranten sollte Gastfreundschaft
und Schutz gewährt werden. Hardenberg richtete einen
Unterstützungsfonds zur Gewährung finanzieller Beihil-
fen in Notlagen ein und sorgte dafür, dass leerstehende
Gebäude, darunter auch Schlösser, zur Unterbringung der
Flüchtlinge genutzt werden konnten. Um eine gleichmä-
ßige Belastung von Städten und Gemeinden mit den fran-
zösischen Emigranten zu erreichen, ordnete er periodisch
zu erstellende Emigrantenlisten an. Trotz zunehmender
Beschwerden aus dem Kreise der Einheimischen ließ sich
Hardenberg in seiner fremdenfreundlichen Politik nicht
beirren. Dies ist insofern bemerkenswert, als die Emigran-
ten in der Mehrzahl der Fürstentümer des Reiches abge-
wiesen wurden. Lediglich für Erlangen erteilte Harden-
berg ab 1794 keine weiteren Aufenthaltsgenehmigungen,
weil sich die dortige Bürgerschaft über die Verteuerung
von Lebensmitteln und Mieten beklagt hatte. Eingehende
Beschwerden über die Gefährdung der guten Sitten wies
Hardenberg dabei zurück.
3 Thomas Höpel: Emigranten der Französischen Revolution in Preussen
1789–1806, Deutsch-Französische Kulturbibliothek Bd. 17, Leipzig 2000.
Schwierig zu ermitteln ist, wie viele französische Emig-
ranten „in diesen glücklichen Landen eine Freystätte“ fan-
den. Die Dunkelziffer der Emigranten ohne Aufenthalts-
genehmigung dürfte hoch gewesen sein. Die statistische
Erfassung der Emigranten in den beiden Fürstentümern
Ansbach und Bayreuth stützt sich, wie Höpel ausführt,
vor allem auf Emigrantenlisten, die im Geheimen Staats-
archiv Preußischer Kulturbesitz heute teilweise noch vor-
handen sind und lediglich für Ansbach und Kulmbach aus
bayerischen Archiven ergänzt werden können. Auf Grund
dieser unvollständigen Aktenlage ermittelt der Autor etwa
eintausend französische Emigranten im Bereich Ansbach-
Bayreuth, deren größte Gruppe Adelige und deren Die-
nerschaft ausmachten.
Hierin liegt ein wesentlicher Unterschied zur Situation
der Emigranten im geistlichen Territorium von Bam-
berg. Matthias Winkler weist 2010 in einer Arbeit über
die „Emigranten der französischen Revolution in Hoch-
stift und Diözese Bamberg“ nach, dass von den über 260
französischen Emigranten, deren Aufenthalt in Bamberg
aktenmäßig zu belegen ist, nur 27 adeliger Herkunft
waren.
4
Es überrascht nicht, dass in einem geistlichen
Fürstentum, wie dem Hochstift Bamberg, der aus Frank-
reich emigrierte Klerus mit 164 Geistlichen besonders
stark vertreten war.
Der „Emigrantenstein“: Identität des Urhebers und
Autors
Das Rätsel der Identität des „französischen Auswande-
rers“, der durch den „Emigrantenstein“ in dieser einzigar-
tigen, zwei Jahrhunderte überdauernden Weise den Dank
für das ihm und seinen Landsleuten gewährte Asyl „ver-
ewigt“ hat, ist noch nicht endgültig gelöst.
Der Wortlaut der Inschrift selbst gibt Anhaltspunkte für
die Recherche. Der Autor zeigt durch die noble Formulie-
rung seines Dankes, dass er die deutsche Sprache perfekt
beherrschte und dem deutschen Kulturkreis eng verbun-
den war. Als Autor wäre vielleicht sogar an den französi-
schen Emigranten Adelbert von Chamisso (1781–1838)
zu denken, der als Dichter und Naturforscher in Deutsch-
land großes Ansehen erlangte. Seine Biographie zeigt, dass
es Emigranten gelungen ist, die Chance des Kulturtrans-
fers zwischen Frankreich und Deutschland zu nutzen. Auf
einem Schloss in der Champagne als „Adélaide de Cha-
misso“ geboren, flüchtete Chamisso mit seinen Eltern über
4 Matthias Winkler: Die Emigranten der Französischen Revolution in Hoch-
stift und Diözese Bamberg, Bamberger Historische Studien Band 5, Bam-
berg 2010.