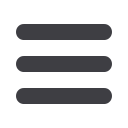

66
Die Türkei 2015: Atatürks Albtraum
Einsichten und Perspektiven 4 | 15
islamische Bildungswesen und trieb die rechtliche Gleich-
stellung der Frauen voran.
16
Die radikale Europäisierung
des Landes zeigte sich auch darin, dass seit Juni 1934 ver-
bindlich Familiennamen getragen werden mussten
17
– ein
Novum in der türkischen Gesellschaft. Dabei waren Ata-
türks Absichten, bevor dieser in den 1920er Jahren mit
seiner republikanischen Partei die faktische Alleinmacht in
der Türkei erlangte, in ihrem Ausmaß und auch in ihrer
Ausrichtung noch nicht abzusehen: Mustafa Kemal war ein
Meister des Pragmatismus – wenn nicht gar des Opportu-
nismus – wenn es der Erreichung seiner Ziele in irgendeiner
Form dienlich war.
18
Personenkult um Atatürk
Auch wenn viele der Atatürk’schen Reformen mit all ihrer
Vehemenz und der brutalen Geschwindigkeit ihrer Umset-
zung in ihrer unmittelbaren Massenwirkung zunächst
begrenzt waren, so führten sie doch langfristig zu einer
weitreichenden Umgestaltung der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse in der Türkei – in den Großstädten, allen voran
Ankara und Istanbul, sehr viel schneller und umfassender
als im Herzen des ländlichen, insbesondere östlichen Ana-
toliens mit seiner konservativen Bevölkerung, die auch
in der Folge dem Bildungs- und Elitensystem der neuen
Türkei eher fern blieb. Trotz aller Säkularisierungs- und
Entislamisierungsbemühungen blieb der Islam für einen
Großteil der türkischen Gesellschaft ein entscheidender
Identifikationsrahmen. Man bemühte sich in der neuen
Wirklichkeit der türkischen Republik sodann um eine
Neudefinition des Verhältnisses von Islam und Moderne.
Jahrzehnte später führte dieser Prozess dazu, dass eine dezi-
16 Lange vor der Umsetzung in vielen europäischen Ländern wurde das akti-
ve Frauenwahlrecht schon in den 1920er Jahren eingeführt; 1934 folgte
auch das umfassende passive Wahlrecht. Die türkische Frauenbewegung
wurde von Atatürk und seinen Gefährten freilich nur so weit unterstützt,
als sie sich dem republikanischen Programm unterwarf und eine kleine
Elite an Vorzeigefrauen produzierte. Von einer umfassenden gesellschaft-
lichen Umwälzung des Verhältnisses von Mann und Frau blieb die Türkei
sehr weit entfernt und ein großer Teil der Bevölkerung seinen konservati-
ven familiären Traditionen verhaftet, vgl. Hanioğlu (wie Anm. 6), S. 212ff.
17 Das „Familiennamengesetz“ schaffte das verwirrende Namenssystem der
osmanischen Zeit ab: Personen waren durch eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Namen und Umschreibungen bezeichnet worden, die neben
Eigennamen etwa auch Rückschlüsse auf den Vater oder den Herkunfts-
ort zuließen. Dabei waren Verwechslungen von Personen mit ähnlichen
„Merkmalen“ an der Tagesordnung, vgl. Hanioğlu (wie Anm. 6), S. 216.
18 So bediente er sich vor 1923 trotz der eigentlichen Verachtung, die er
für die Religion übrig hatte, durchaus islamischer Rhetorik, da er dies
angesichts einer stark muslimisch geprägten Gesellschaft als erfolgsver-
sprechend erkannte. Dasselbe galt für die Verwendung pseudo-kommu-
nistischer Sprachformeln, die es ihm erlaubte, sich die sowjetische Groß-
macht gewogen zu halten. Vgl. das Kapitel „Islamischer Kommunismus?
Der Türkische Befreiungskrieg“, in: Hanioğlu (wie Anm. 6), S. 102–141.
diert islamische Partei wie die
AKP
im Lande Atatürks an
die Macht kommen konnte.
Neben den heute weitgehend als „positive Verwestli-
chung“ wahrgenommenen Veränderungen in der türki-
schen Gesellschaft waren Atatürk und Gefolge auch vor
problematischem europäischen Gedankengut nicht gefeit:
Sie importierten mit dem europäischen Fortschrittsge-
danken zugleich auch sozialdarwinistischen Rassismus,
aggressiven Nationalismus und autoritäre Herrschafts-
muster. Als Auswüchse des Versuches, die islamische
Religion durch ein anderes Identifikationsobjekt zu erset-
zen, können die pseudo-wissenschaftliche „Türkische
Geschichtsthese“
(Türk Tarih Tezi),
die Zentralasien und
namentlich Anatolien als Wiege der Menschheit und die
Türken als Begründer der Zivilisation propagierte, und
die sogenannte „Sonnensprachtheorie“ des dubiosen ser-
bischen „Sprachpsychologen“ Hermann Feodor Kvergić
gelten, der das Ur-Türkische als erste Sprache der Mensch-
heit identifiziert haben wollte. In der Republik bediente
man sich dieser scheinbar wissenschaftlich verbürgten
Genialität der türkischen Nation nur allzu gerne, um die
eigene Überlegenheit gegenüber anderen Völkern heraus-
zustreichen und die osmanische Geschichte, mit der man
brechen wollte,
19
stillschweigend zu übergehen.
Der quasi-religiöse Personenkult um die Symbolfigur
Mustafa Kemal, der 1938 starb, trieb teils bizarre Blü-
ten:
20
1954 hatte ein junger Hirte in der ostanatolischen
Provinz eine Erscheinung. In einem Schatten, den die
Sonne auf einen Hügel warf, wollte er den Republikgrün-
der erkannt haben und meldete das „Wunder“ den loka-
len Behörden, die es sogleich öffentlich verkündeten. Seit
1997 wird am Schauplatz des Geschehens alljährlich ein
Festival veranstaltet, zu dem unzählige Besucher anreisen,
um das „Wunder“, das bei entsprechenden Tageszeit- und
Lichtverhältnissen schlicht und einfach einen Schatten in
Form der umliegenden Hügel zeigt, mit eigenen Augen
zu sehen. 2004 aber ereignete sich Ungeheuerliches, eine
„Respektlosigkeit sondergleichen“, „Hochverrat“, wie
ein türkischer Parlamentsabgeordneter wissen ließ: Ein
nichtsahnender Schäfer war just in dem Moment, in dem
der Schatten sich zeigte, in die Silhouette Atatürks hinein-
gelaufen. Die Menge tobte vor Zorn.
19 Hanioğlu betont die lange vernachlässigten Kontinuitäten der spätosmani-
schen zur türkisch-republikanischen Geschichte: Er verweist insbesondere
auf intellektuelle Strömungen im Osmanischen Reich, die schon längst Ge-
danken beinhalteten, die Atatürk später für sich allein beanspruchen sollte.
Auch die Reformbemühungen der Tanzimat-Zeit sprechen für eine längere
Tradition der allmählichen gesellschaftlichen Veränderungsprozesse.
20 Die Szene ist beschrieben bei Hanioğlu (wie Anm. 6), S. 22 f.


















