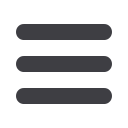

49
Ein Interview mit Prof. Dr. Christoph K. Neumann
Einsichten und Perspektiven 3 | 16
mehr so attraktiv. Aber jetzt ist die Türkei noch eine rie-
sige Wachstumsmaschine.
Jetzt ist es allerdings völlig unmöglich, die Türkei auf-
zunehmen. Das heißt nicht, dass man die Verhandlungen
abbrechen muss. Das muss man überhaupt nicht, sie führen
ja ohnehin zu nichts mehr. Wenn die Türkei jetzt die Todes-
strafe wieder einführen sollte – wonach es eigentlich nicht
aussieht – das wäre wahrscheinlich schon formal ein Argu-
ment, aber ansonsten: Wie soll man sich mit so einem Land
gegenseitig integrieren? Das Land bewegt sich momentan
noch schneller von den bürgerlichen Freiheiten weg als sol-
che Länder wie Frankreich, wo wir ja auch eine unglaub
liche Situation haben im Moment: mit Ausnahmezustand,
mit Möglichkeiten, Leute über lange Zeit festzusetzen, zu
Nachverurteilungen, dazu, Freigelassene weiter zu überwa-
chen und so weiter. Das sind keine guten Aussichten, aber
in der Türkei sind sie noch deutlich düsterer.
Im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt wird häufig auch
Ankaras Weigerung, den Genozid an den Armeniern anzu-
erkennen, genannt. Wie stehen Sie zur Bundestags-Reso-
lution vom Juni
11
, die die jungtürkischen Massaker an den
Armeniern unmissverständlich als Völkermord deklariert?
Ich finde, diese Resolution ist nicht weit genug gegan-
gen, insofern als sie zu wenig unterschieden hat zwischen
Tätern und Opfern. Die Überschrift ist relativ deut-
lich, aber danach wird eigentlich so getan, als sei das ein
gemeinsames hartes Schicksal von Türken und Armeni-
ern. Der Erste Weltkrieg ist in Anatolien und in anderen
Teilen des Osmanischen Reichs ganz besonders grässlich
gewesen, auch für Nicht-Armenier. Aber das, was den
Armeniern angetan wurde, war etwas Eigenes und das
bedeutet auch, dass es eigens behandelt werden müsste.
Hier ist die Resolution nicht weit genug gegangen. Sie
hätte außerdem zum Beispiel so etwas ansprechen kön-
nen wie die Durchsetzung der im Vertrag von Lausanne
den Armeniern zugebilligten Rechte,
12
die ja in der Türkei
11 Antrag und Begründung sind auf der Seite des Bundestags im Wortlaut
nachzulesen:
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/086/1808613.pdf[Stand: 10.10.2016].
12 Im Vertrag von Lausanne vom 23. Juli 1923, mit dem der Erste Weltkrieg
beendet und der Sieg der türkischen Unabhängigkeitsbewegung unter
Mustafa Kemal offiziell anerkannt wurde, wurden die Armenier nicht na-
mentlich erwähnt; die türkische Regierung verpflichtete sich jedoch zum
Schutz aller Bürger unabhängig von Religion, Ethnizität oder Sprache.
Religiöse Gebäude und Schulen der nichtmuslimischen Minderheiten, die
innere Organisation ihrer Gemeinschaften sowie die Verwendung ihrer
Sprachen auch im öffentlichen Raum wurden unter Schutz gestellt. Die
Einhaltung der Regelungen in der Türkei sollten durch den Völkerbund
überwacht werden.
nicht durchweg angewandt werden. Sie hätte von Mög-
lichkeiten der Anerkennung durch Erben der Täter spre-
chen können, aber das alles steht nicht darin. Insofern war
es eine Mindest- und keine Maximalerklärung.
Natürlich ist auch der Zeitpunkt der Resolution ein
bisschen spät. Die Vernichtung der Armenier war bereits
2015 hundert Jahre her. Ob der Zeitpunkt nun diploma-
tisch geschickt war oder nicht – so eine Erklärung ist selbst
in ihrer windelweichsten Fassung wie dieser diplomatisch
immer ein Affront, wenn die andere Seite es nicht aner-
kennen will. Andererseits gehört so eine gewisse Anerken-
nung von historischer Schuld und Verantwortung mög-
licherweise auch zum Bestand der EU. Aber die EU gibt
ihren Wertebestand ohnehin auf, deshalb würde ich das
mal nicht zu hoch hängen. Man muss auch dazu sagen: Es
war nicht das europäische Parlament, das diese Resolution
veröffentlicht hat, es war das deutsche.
Die deutschen Verbündeten haben schließlich auch dazu
beigetragen, dass der Genozid geschehen konnte. Der türki-
sche Gründervater Mustafa Kemal Atatürk war bekannter-
maßen nicht daran beteiligt – an der großen Symbolfigur
der Türkei wurde mit der Resolution also nicht gerüttelt.
Nicht einmal Erdoğan kann es sich leisten, sich in der Öf-
fentlichkeit deutlich von Atatürk zu distanzieren – auch
wenn seine Politik in vielerlei Hinsicht in eine entgegenge-
setzte Richtung zeigt. Wie steht es eigentlich um das kema-
listische Erbe in der Türkei?
Atatürks Politik selbst hat natürlich mit der Politik von
heute relativ wenig zu tun. Man muss bei Atatürks Poli-
tik mindestens drei Phasen unterscheiden: Die Phase des
Unabhängigkeitskriegs, die Phase vor der Weltwirtschafts-
krise 1929 und die Phase danach. Demokratisch war übri-
gens keine dieser Phasen. Was auch nicht erstaunlich ist
und keine große Ausnahme. Insofern ist aber jedes kema-
listische Erbe auch problematisch. Das Problematische am
kemalistischen Erbe in der Türkei heute ist, dass es nicht
hinreichend problematisiert wird. Erdoğan wird nicht so
dumm sein, diese Identifikationsfigur zu demolieren oder
zu demontieren. Aber er macht das Klügste, das er tun kann:
sie ein wenig verblassen zu lassen. Das wird auch weiterge-
hen. ImMoment ist es so, dass der Kemalismus, oder besser
das, was sich in der Türkei noch als Kemalismus oder als
Atatürkismus ausgibt, im Wesentlichen der Laizismus ist,
also Kontrolle der sunnitisch-muslimischen Religion durch
den Staat und Marginalisierung aller anderen Bekenntnisse
und Religionen: Aleviten, die keine eigenen Rechte als reli-
giöse Gemeinschaft haben, Marginalisierung von Christen
und Juden und was es sonst noch so geben mag.


















