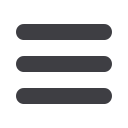

„Deutschland ist ein wunderbares Land, Gott, ist das schön. Aber wir wollen nicht zurück.“
6
Einsichten und Perspektiven Themenheft 1 | 15
„Deutschland ist ein wunderbares
Land, Gott, ist das schön. Aber wir
wollen nicht zurück.“
1
von Peter Zinke und Robert Sigel
Wenige Jahre nach der israelischen Staatsgründung wurde
es errichtet, das „
Pinchas Rosen Parents’ Home
“ in Ramat
Gan (auf Deutsch: „Gartenhöhe“) bei Tel Aviv. Benannt
ist diese wunderbare, lichte Wohnanlage nach Felix Rosen-
blüth. Rosenblüth, ein deutscher Jude und Jurist, hatte
wie so viele Auswanderer nach seiner Emigration in den
zwanziger Jahren seinen Namen hebräisiert. Pinchas Rosen
wurde 1948 der erste Justizminister des neu gegründeten
Staates Israel und war zwanzig Jahre lang Mitglied der
Knesset, des israelischen Parlaments. Pinchas Rosen war
auch Mitbegründer der „Vereinigung der Israelis mittel-
europäischer Herkunft“, das heißt derjenigen Israelis, die
deutschsprachig und von deutscher Kultur geprägt waren,
also aus Deutschland stammten, aus Österreich oder der
Schweiz, auch aus der Tschechoslowakei und anderen Län-
dern;
„Jeckes“
wurden diese deutsch sozialisierten Juden
genannt und für sie wurde das „
Pinchas Rosen Parents’
Home
“ gegründet. Zwar liegen auch heute noch deutsche
Zeitschriften im Foyer aus, zwar sind viele der Hinweise
auch heute noch auf Deutsch geschrieben, aber der deut-
sche Charakter des Heimes schwindet, die sogenannten
Jeckes
stellen inzwischen eine Minderheit dar.
Eretz Israel
Die deutschsprachigen Einwanderer kamen überwiegend
erst nach 1933 in das damalige britische Mandatsgebiet
Palästina, nach 1948 dann diejenigen, die überlebt hat-
1 Zitat aus dem Interview mit Lea Jacobstamm, siehe S. 6.
ten und nun, nach der israelischen Staatsgründung, nicht
mehr an der Einreise gehindert wurden. In den zionisti-
schen Einwanderungswellen zuvor hatten sich vor allem
Juden aus Russland und Polen auf den Weg gemacht.
Eigentlich hätte 1897 München zum Geburtsort des
Zionismus werden können, denn der Wiener Journalist
Theodor Herzl wollte in München den ersten zionisti-
schen Weltkongress veranstalten. Doch sowohl der Allge-
meine Deutsche Rabbinerverband als auch die Israeliti-
sche Kultusgemeinde in München lehnten einen solchen
Kongress, lehnten die Idee des Zionismus, die Gründung
eines jüdischen Staates in Palästina, ab. Sie fühlten sich
als Deutsche, als jüdische Deutsche, die Gründung eines
Judenstaates schien den allermeisten von ihnen zwar unter-
stützenswert, aber
Eretz
(„Land“)
Israel
galt ihnen selbst
nicht als wirkliche Alternative. Die Juden in Deutschland
waren gleichberechtigt, häufig assimiliert; in allen Berei-
chen der Gesellschaft, vom Sport bis zur Wissenschaft,
von der Wirtschaft bis zu Kunst und Literatur leisteten
deutsche Juden einen wichtigen Beitrag zu Fortschritt und
Wohlergehen, als Patrioten hatten sie im Ersten Weltkrieg
einen sehr hohen Blutzoll geleistet.
Seit den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts äußer-
ten sich auch in Deutschland wieder antisemitische Strö-
mungen, in Österreich errang der Antisemitismus sogar
einen ersten großen politischen Erfolg: 1895 wurde der
Antisemit Karl Lueger mit deutlicher Mehrheit zum Bür-
germeister von Wien gewählt. Ein anderer Österreicher,
Theodor Herzl, der Begründer des Zionismus, war zu die-
ser Zeit schon vier Jahre Pariser Korrespondent der Wiener


















