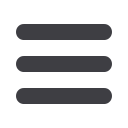

57
„With human beings you never know“
Einsichten und Perspektiven 3 | 16
renden Stämmen setzte sich ein Stammesführer durch
und begründete durch Einverleibung anderer das König-
reich, das bis ins 20. Jahrhundert Bestand haben sollte.
Wer heute das
King’s Palace Museum
in Nyanza besucht,
kann erahnen, wie diese Herrschaft strukturiert war: Die
königliche Familie entstammte der Führungselite der
Tutsi, die das Land beherrschte, Hof hielt, Recht sprach
und die berühmten Langhörner-Rinder als Zeichen des
Reichtums und des Herrschaftsanspruches hielt.
Etwa 80 bis 85 Prozent der Bevölkerung stellten dage-
gen die Ackerbau treibenden Hutu. Zwar gab es innerhalb
der Elite auch Hutu, außerdem kam es mitunter zu einer
Vermischung und soziale Aufstiegsmöglichkeiten waren
ebenfalls prinzipiell vorhanden, dennoch blieben die meis-
ten Hutu tendenziell eher arme Bauern. Die Tutsi hatten
die politisch-militärische Macht inne. Doch weil den Hutu
übernatürliche Kräfte nachgesagt wurden, scharte der
König am Hof auch einen Beraterstab aus Hutu um sich.
Erst im 19. Jahrhundert kam es zu einer Bodenreform
und damit zu Umverteilungen, die aus manchen Hutu
Abhängige der regionalen Tutsi-Eliten, vergleichbar mit
Leibeigenen, machten und die soziale und ökonomische
Ungleichheit vertieften. Grundsätzlich ist festzuhalten,
dass es sich trotz dieser Gesellschaftsschichten um ein
Volk handelte, das sich über Jahrhunderte auf dem glei-
chen Territorium befand und – eine absolute Besonderheit
in den Ländern des subsaharischen Afrika – eine einzige
gemeinsame Sprache nutzte: Auch heute beherrschen zwi-
schen 80 und 90 Prozent aller Menschen nur ihre gemein-
same Muttersprache
Kinyarwanda
.
Am Ende des 19. Jahrhunderts teilten bekanntermaßen
die Kolonialmächte Afrika untereinander auf. Ruanda
wurde dem deutschen Reich zugeschlagen und der soge-
nannten deutschen Kolonie Ost-Afrika unterstellt. Bereits
im Ersten Weltkrieg besetzten Belgier aus Belgisch-Kongo
strategisch wichtige Positionen und 1917 sprach der Völ-
kerbund das Land schließlich Belgien zu. Sowohl Deut-
sche wie Belgier kontrollierten das Land durch eine soge-
nannte indirekte Herrschaft: Man baute keine eigene
Verwaltungsstruktur auf, sondern arbeitete mit der herr-
schenden Elite und damit den Tutsi zusammen.
Die Kolonialmächte begannen, die zunächst gesell-
schaftlichen, offenen Kategorien der Schichtzugehörig-
keit nach rassistischen Kriterien mitsamt wirtschaftlicher
Zuschreibung neu zu definieren. So wurde eine sehr viel-
fältige Gesellschaft, die über Jahrhunderte hinweg den
Austausch zwischen einzelnen Gruppen ebenso gekannt
hatte wie sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg und in
der man zudem neben der gleichen Sprache auch densel-
ben Glauben, dieselben Kulturformen und Traditionen
teilte, in kurzer Zeit zu einer Gesellschaft einzelner „Ras-
sen“. Insgesamt drei waren dabei für die Kolonialmächte
auszumachen: Zum ersten die Tutsi, eine aus dem Niltal
eingewanderte Minorität, im Sinne der damals vertrete-
nen hamitischen Unterscheidung sozusagen berufen zur
Herrschaft, angeblich hochwüchsig und eher hellhäutig.
Sie verdienten ihren Lebensunterhalt vornehmlich mit der
Rinderzucht. Zum zweiten die Hutu, die eher als boden-
verhaftet, servil und kulturell unterlegen geltenden, ansäs-
sigen dunkelhäutigen Bauern mit gedrungenem Körper-
bau. Zum dritten schließlich die Twa, eine verschwindend
kleine Minderheit, die nicht so deutlich einzuordnen war
und weder Rinderzüchter noch Bauern waren, also jene
„Rasse“ der Sammler, Töpfer, etc.
Die Zuordnung nahm kuriose und zugleich folgenrei-
che Formen an: Bei einer Volkszählung in der Mitte der
1930er Jahre wurde etwa einfach nach dem Besitz von
Rindern entschieden, ob man zu den Tutsi (mit mehr
als zehn), den Hutu (nur wenigen) oder Twa (gar keine)
gehörte. Nach dieser Volkszählung wurde die entspre-
chende Rasse, als „Ethnie“ oder „Volksstamm“ in den Per-
sonalausweis eingetragen.
Die Kennzeichnung als „Tutsi“ sollte einige Jahrzehnte
später während des Genozids für viele Menschen das
Todesurteil bedeuten. An Straßensperren wurden die Pässe
der Menschen kontrolliert und sie – je nach angegebener
ethnischer Zugehörigkeit – entweder ermordet oder lau-
fen gelassen. Dieser Teil der Erzählung – und damit auch
die Abbildung der Pässe – fehlt daher in keinem der gro-
ßen Dokumentationszentren in Ruanda. Zweifellos war
diese zu Beginn des 20. Jahrhunderts von der Kolonialver-
waltung geschaffene Stereotypenbildung und Zuordnung
mörderisches Gift für die weitere Entwicklung Ruandas.
Doch andere wirtschaftliche und politische Faktoren, die
zumindest Teilaspekte des Völkermordes erklären und
seine Vielschichtigkeit beschreiben können, werden darü-
ber vernachlässigt – sozusagen eine
untold story
. Damit sei
auf die gleichnamige BBC-Dokumentation verwiesen, die
in Ruanda nach Aussagen unserer Begleiter verboten ist.
7
Hier wird die komplexe Geschichte des Völkermordes und
seiner Gründe aus differenzierter Sicht dargestellt.
7 Die Dokumentation „
The untold story
“ wurde aus Anlass des 20. Jahresta-
ges des Genozids 2014 von der BBC produziert. Sie hinterfragt die Rolle
der RPF (Ruandische Patriotische Front) und den Mord an den gemäßigten
Hutu im Rahmen der Massenmorde und allgemein der Übergriffe gegen-
über Hutu während der Beendigung des Völkermordes durch die RPF. Der
Film führte zu massiven Auseinandersetzungen zwischen der ruandischen
Regierung und der BBC.


















