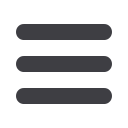
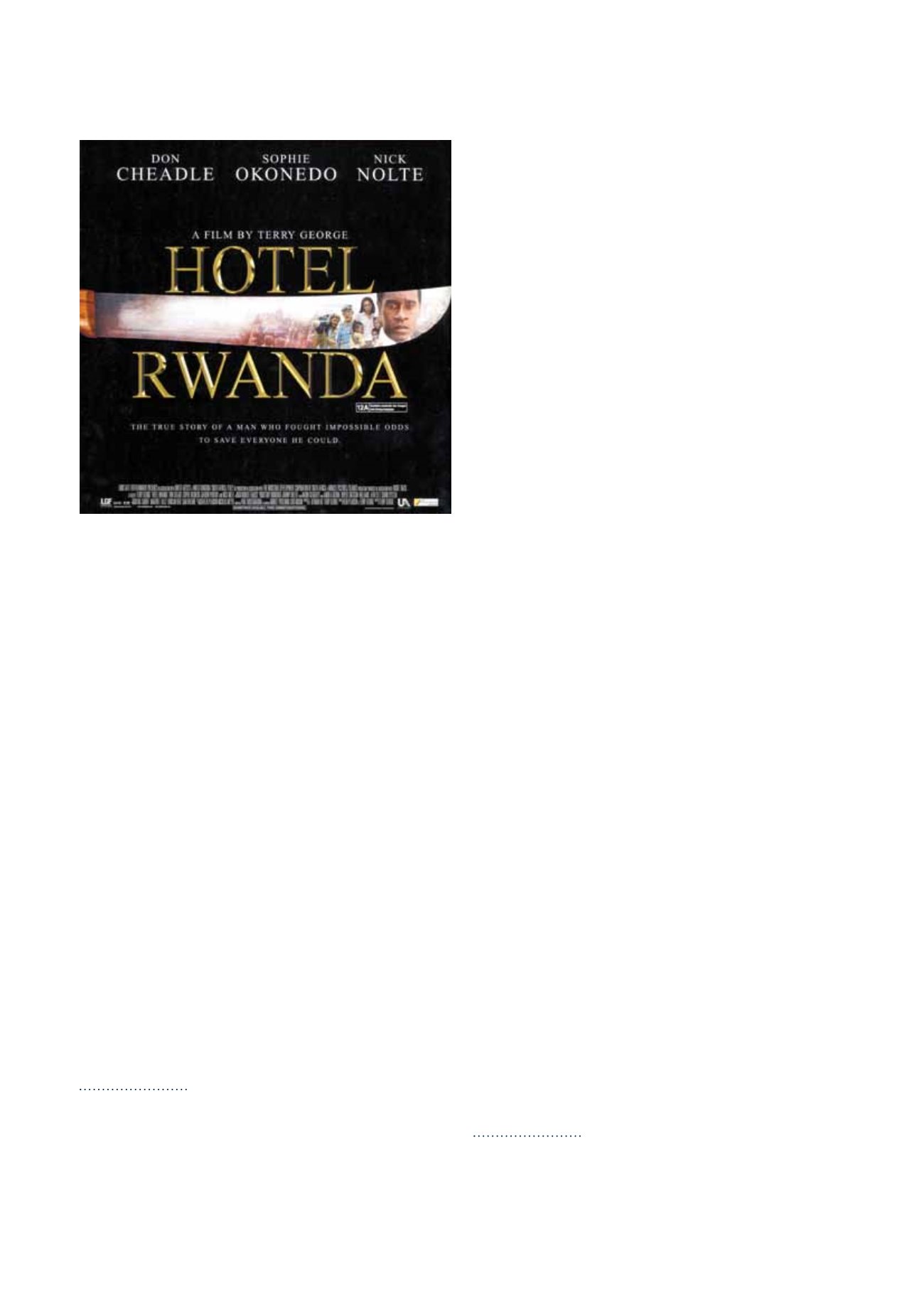
61
„With human beings you never know“
Einsichten und Perspektiven 3 | 16
das in einer Haltung des „Wir-oder-sie“ eskaliert. Drit-
tens schließlich kulminiert dieses beschworene Reinheits-
bedürfnis in der Herbeiführung einer endgültigen und
unwiderruflichen Lösung durch Beseitigung und Elimi-
nierung nicht nur der Bedrohung, sondern des Anderen.
14
Manche Analogien sind greifbar. Wer die Sprache der
Demagogen bei
Hate Radio
analysiert oder die damaligen
Karikaturen der Zeitschrift
„Kangura“
betrachtet, wird an
die Reden auf den Reichsparteitagen und den radikalen
Rassismus von Julius Streichers „Stürmer“ erinnert. Hier
wie dort wurde eine Gruppe zutiefst entmenschlicht,
als „Ungeziefer“, „Ratten“ und „Kakerlaken“ bezeichnet
und damit der Boden für den Mord bereitet. Besonders
erschütternd sind die Interviews, die Jean Hatzfeld mit
Opfern und Tätern führte, die wörtlich bestätigen: Die
Tutsis wurden nicht mehr als Menschen, nicht einmal
mehr als Geschöpfe Gottes betrachtet.
15
Erschreckend für uns, die wir den Spuren in Ruanda
nachgehen, stellt sich die Erkenntnis dar, dass dieses Mor-
den „ein Genozid der Nähe und der Nachbarschaft, nicht
14 Vgl. Jacques Sémelin: Säubern und Vernichten. Die politische Dimension
von Massakern und Völkermorden. Hamburg 2007.
15 Vgl. Jean Hatzfeld: Nur das nackte Leben. Berichte aus den Sümpfen Ru-
andas, Gießen 2004, sowie zu den beeindruckenden Interviews mit den
Tätern Jean Hatzfeld: Zeit der Macheten. Gespräche mit den Tätern des
Völkermordes in Ruanda, Gießen 2004.
der Ferne und der Deportation war“,
16
wie es Milo Rau
formuliert. Aber das Zerbrechen einer früheren gemein-
samen Lebenswelt mit gemeinsamen Leidenschaften und
Problemen, bleibt als verbindendes Element gegenüber
der eigenen, deutschen Geschichte. Und ebenso manche
Mosaiksteinchen, wie die Begeisterung der Täter für ein
erfüllendes Projekt. Eine Generation war herangewach-
sen, die eine Mischung aus Destruktivität, Nihilismus und
dem enttäuschten Wunsch nach einer echten, erfüllenden
Revolte prägte. Und wie die damalige Studentin Dorcy
Rugamba im Rückblick formuliert: „Meine Großeltern
haben für die Unabhängigkeit gekämpft, meine Eltern
haben Ruanda aufgebaut – und für meine Generation war
das einzige Projekt der Genozid.“
17
Die 100 Tage und die Verantwortung des Westens
Der 6. April 1994 gehört zu den einschneidenden Daten
der ruandischen Geschichte. Die Maschine des Präsiden-
ten Juvénal Habyarimana wird beim Landeanflug in Kigali
abgeschossen und alle Insassen sterben. Regierungsvertre-
ter beschuldigen die Tutsi-Rebellen, noch in der Nacht
beginnt die Präsidentengarde, Oppositionelle zu ermorden
und im Radio wird zur Eliminierung aller Tutsi im Lande
aufgerufen. Der Anlass war nun gegeben, den Völkermord
an den Tutsi systematisch zu starten. Längst waren Todes-
listen vorbereitet worden, Tausende von Macheten an die
Bevölkerung verteilt. Die Propaganda hatte die Köpfe vor-
bereitet, um Hand anzulegen an jene, die als „Feinde“ sys-
tematisch erschaffen worden waren. Die Angst vor einem
vorrückenden Feind wurde geschürt und damit der eigene
Nachbar zur Bedrohung. Der Genozid sollte 100 Tage
dauern und mindestens 800.000 Menschen, Regierungs-
angaben sprechen gar von 1,174 Millionen, das Leben
kosten. Die Zahlen können nur Schätzungen sein, vor
allem hinsichtlich der Zuordnung der Opfer: Denn neben
den Tutsi wurden auch gemäßigte Hutu in großer Zahl
ermordet und beim Vorrücken der RPF, die dem Morden
ein Ende setzte, wurden ebenfalls viele Hutu getötet.
Die internationalen Reaktionen auf diesen unfassbaren
Ausbruch der Gewalt gehören zweifellos zu den dunkelsten
Stunden der internationalen Staatengemeinschaft, ihrer Ins-
titutionen und Vertreter. Sie lassen sich nur aus der Gemen-
gelage der machtpolitischen und postkolonialen Interessen
der einflussreichsten Industriestaaten und mancher zählebi-
16 Rau (wie Anm. 9), S. 22.
17 Ebd., S. 26, der Bericht von Dorcy Rugumba: Die verwöhnten Kinder der
dritten Welt, S. 122–130.
Hotel Ruanda - ein bewegender Film über die Geschichte des Genozids aus
dem Jahr 2004
Foto: Interfoto/Mary Evans/United Artists/Six Sense Productions/Miracle
Pictures/Ronald Grant Archive


















