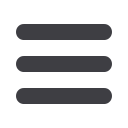

67
Rezeption der Weißen Rose in der Sowjetischen Besatzungszone und frühen DDR
Einsichten und Perspektiven 3 | 16
Neben der Geschichte der Weißen Rose sind inzwi-
schen sowohl ihre Rezeption als auch die Formen ihres
Gedenkens fester Bestandteil der Widerstandsfor-
schung.
1
Bereits unmittelbar nach dem Ende des Natio
nalsozialismus entstanden sowohl in West- als auch in
Ostdeutschland verschiedene öffentliche Veranstaltun-
gen und Aktionen, die Gedenken wie politisches Erbe
der Widerstandsgruppe wachhalten sollten. Ergän-
zend zu periodisch begangenen Gedenktagen fanden
in beiden deutschen Staaten bereits früh Straßen- und
Platzbenennungen, aber auch Betitelungen von öffent-
lichen Einrichtungen (vor allem von Schulen) – meist
nach den Geschwistern Scholl – statt. Die gegenseitige
Beurteilung der beiden deutschen Gedenkkulturen fiel,
im Rückblick sicherlich nicht weiter verwunderlich,
konfrontativ aus: Im deutsch-deutschen Antagonis-
mus warf man sich vor, der jeweilig andere Staat sei
in seiner Erinnerungskultur tendenziös und selektiv
im Sinne der jeweiligen ideologischen Grundlagen –
zwischen antifaschistischem Widerstand und unpoli-
tischem Martyrium der Weißen Rose. Im Rückblick
ist sich die Geschichtsforschung heute grundsätzlich
einig, dass die Darstellung der Weißen Rose und das
Gedenken an den Widerstandskreis in zeithistorischen
Kontexten betrachtet werden muss. Schließlich gab
es, was die NS-Vergangenheit betraf, in beiden deut-
schen Staaten „hocheffektive, politische Wachposten“.
2
Erinnerung fand damit unter ideologischen Einflüssen
und mit politischen Absichten statt, „immer blieb die
Weiße Rose mehr die Projektionsfläche der Nachge-
borenen als das Ergebnis der Auseinandersetzung mit
jenen Inhalten, die die sechs Flugblätter der Weißen
Rose 1942 / 43 vermittelten.“
3
1 Siehe zuletzt etwa Hildegard Kronawitter: Sophie Scholl. Eine Ikone des
Widerstands, in: Einsichten und Perspektiven. 2/2014, S. 80–91; dies.,
25 Jahre Weiße Rose Stiftung e.V. Ein Beitrag zur Erinnerungskultur,
in: dbd. 1/2013, S. 6–17; Kristina Kargl: Die Weiße Rose. Defizite einer
Erinnerungskultur: Einfluss und Wirkung des Exils auf die Publizität der
Münchner Widerstandsgruppe, München 2014; Christine Hikel: Sophies
Schwester. Inge Scholl und die Weiße Rose, München 2013.
2 Michaela Hänke-Portscheller u.a.: Im Gespräch, in: Landeshauptstadt
München (Hg.): Der Umgang mit der Zeit des Nationalsozialismus. Pers-
pektiven des Erinnerns, München 2007, S. 16–29, hier S. 18.
3 Johannes Tuchel: Im Spannungsfeld von Erinnerung und Instrumentali-
sierung. Die Wahrnehmung der studentischen Widerstandsgruppe Weiße
Rose im westlichen Nachkriegsdeutschland bis 1968, in: Mathias Rösch
(Hg.): Erinnern und Erkennen. Festschrift für Franz J. Müller, Stamsried
2004, S. 45–59, hier S. 59.
Erinnerungskultur in der Sowjetischen Besatzungs
zone und frühen DDR
4
Pfingsten 1947 hielt Paul Verner (1911–1986)
5
auf dem
II. Parlament der Freien Deutschen Jugend (FDJ) in Mei-
ßen eine Rede zu Ehren der Opfer des Faschismus. Darin
gelobte er mit allen Anwesenden, dass die Taten undWorte
aller Widerstandskämpfer für Freiheit und gegen den
Nationalsozialismus nicht vergebens gewesen seien: „Sie
werden weiterleben. Sie sollen die Vorbilder einer neuen
deutschen demokratischen Jugend sein.“ Unter den jungen
Kommunisten, Christen und Studenten, „die in den lan-
gen Jahren der nazistischen Macht ihre Ideale nicht aufga-
ben und sich mit ihren jungen Kräften, oft gemeinsam der
braunen Sintflut entgegenstemmten“, wurde bereits hier
die „Studentengruppe Geschwister Scholl“ ausdrücklich
hervorgehoben. So zitierte Verner aus dem Abschiedsbrief
Alexander Schmorells an seine Eltern, und das Bild der
Geschwister Scholl fand sich imVeranstaltungsdruck unter
wenigen anderen Portraits. Besonders den Vorbildcharak-
ter der jugendlichenWiderständler hob der Redner hervor:
„Mit Fug und Recht bezeichnen wir diese Menschen als
wahrhafte Helden, als Menschen, die wir verehren und als
Vorbilder, denen wir nacheifern sollen.“
6
In den folgenden Jahren stilisierte man die Mitglieder
der Weißen Rose zu bedeutenden Identifikationsfiguren der
ostdeutschen Jugend. Der „Tag der jungen Widerstands-
kämpfer“ wurde nun bewusst am Todestag von Christoph
Probst sowie Hans und Sophie Scholl, am 22. Februar in
Zusammenarbeit von FDJ und der Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes (VVN) abgehalten.
7
Besonders die
4 Wesentliche Informationen und Quellenhinweise zur Erinnerungskultur in
der SBZ und frühen DDR verdanke ich der grundlegenden wissenschaft-
lichen Abschlussarbeit von Christian Ernst: Öffentliche Erinnerung an die
„Weiße Rose“ im Ost-West-Vergleich. Studien deutsch-deutscher Erinne-
rungsdiskurse (1943–1973), die der Autor im März 2009 an der Universi-
tät Potsdam eingereicht hat und die ich aus dem Archiv der Weiße Rose
Stiftung e.V. erhalten habe.
5 Paul Verner war bereits in den 1920er Jahren im Kommunistischen Jugend-
verband Deutschlands und später als Journalist in kommunistischen Jugend-
organen aktiv. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland wurde er Mitbegrün-
der der FDJ und Chefredakteur im FDJ-gelenkten Verlag Neues Leben. Als
Parteivorstand der SED war er zudem für Jugendfragen zuständig.
6 Paul Verner: Zu Tode geführt und siehe sie leben!, Berlin 1947, S. 7–11.
7 „Über alle Schichten, Konfessionen und Rassen und Parteien hinweg“ hat-
ten „sich die Kämpfer gegen den Nazismus und die vom Nazi-Regime Ver-
folgten“ (Programm) im August 1946 als VVN zusammengeschlossen. In
den Folgemonaten entstanden verschiedene Landes- und Zonenverbände,
so auch am 22./23. Februar 1947 in Berlin für die SBZ. Der Aufbau einer
neuen Welt des Friedens und der Freiheit war das gemeinsame Ziel. Am
15. Januar 1953 wurde die Auflösung der VVN in der DDR beschlossen, am
21. Februar stellte sie ihre Arbeit ein. An die Stelle der VVN trat nun das
Komitee der Antifaschistischen Widerstandskämpfer.


















