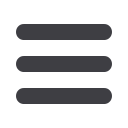
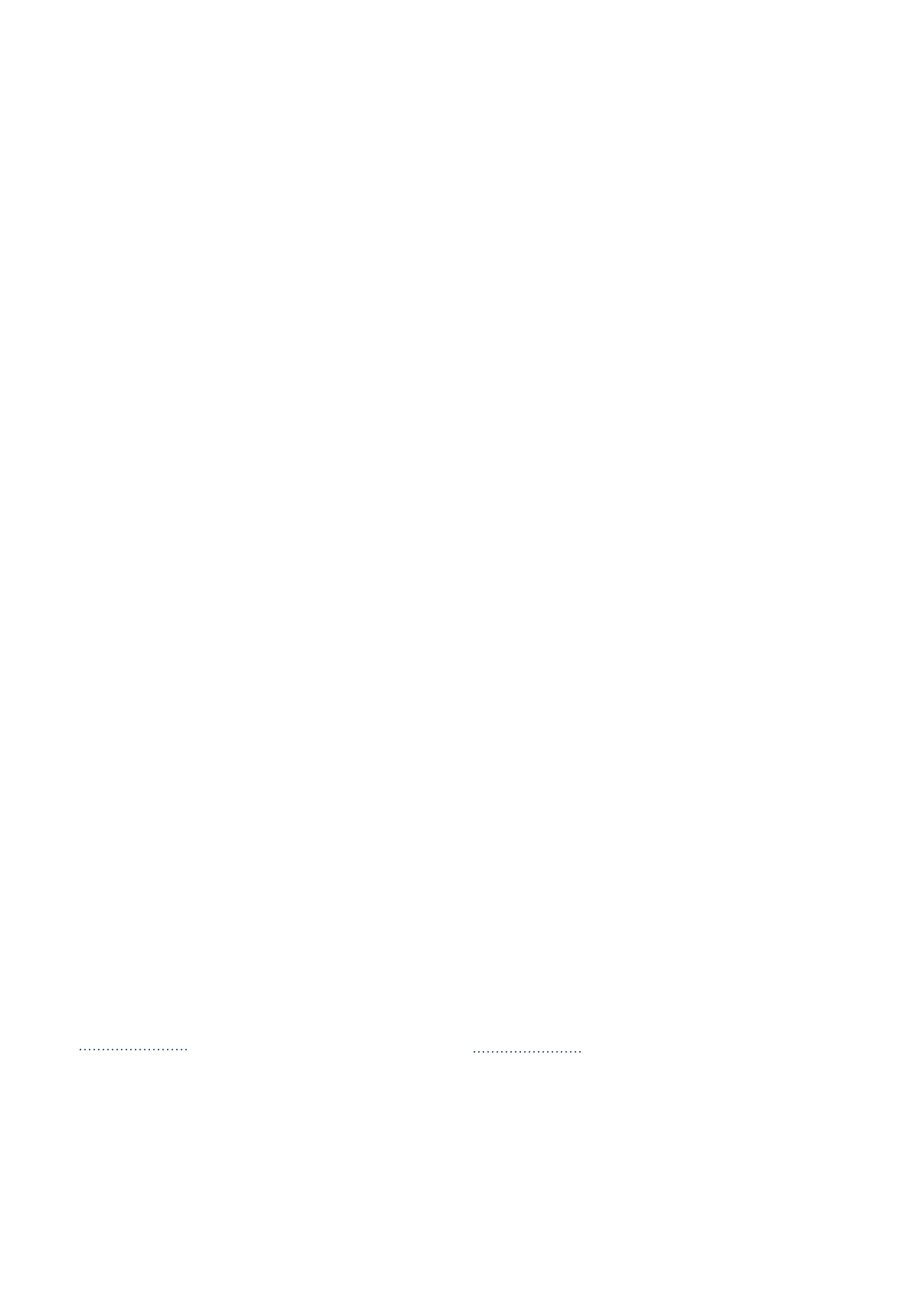
33
Einsichten und Perspektiven 1 | 18
Die erste industrielle Retortenstadt der Sowjetunion wurde
zum überwältigenden Prestigeobjekt und Schaufenster des
Sozialismus. Vom Prinzip her war Magnitogorsk der ame-
rikanischen Stahlstadt Gary in Indiana nachempfunden.
Die Technologie für das Stahlwerk lieferte die unter Vertrag
genommene US-Firma McKee aus Cleveland. Für den Ent-
wurf einer neuartigen „Bandstadt“, der besonderes Augen-
merk auf kurze Wege zwischen Fabrik- und Wohnviertel
legte, gewann die Sowjetunion den deutschen Stadtplaner
Ernst May, an dessen Konzept die Verantwortlichen bald
aber immer mehr Abstriche machten.
Trotz der Enttäuschung über May setzte die zu Mitte
der 1930er Jahre schon von 250.000 Menschen bewohnte
Industriestadt Magnitogorsk Wegzeichen für die Ent-
wicklung der sowjetischen Urbanität. Zudem lieferten
ihre gigantischen Hochöfen und Walzwerke den Stahl,
den die Sowjetwirtschaft dringend für den rasanten Wan-
del ihrer Schwer- und Rüstungsindustrie brauchte. Als
stählerne Wiege der sowjetischen Industriezivilisation
stellt Magnitogorsk einen Mikrokosmos dar, in dem sich
sowohl die Errungenschaften als auch die Verwerfungen
des ersten Fünfjahresplans beobachten lassen. Die neue
Rüstungsschmiede schöpfte aus dem Vollen und zwar aus
allen Bereichen der Sowjetgesellschaft. Neben einem Heer
an Zwangsarbeitern kamen nicht wenige Freiwillige vol-
ler Enthusiasmus nach Magnitogorsk. Andere versuchten
hier verzweifelt irgendeinen Arbeitsplatz, eine Schlafprit-
sche oder eine Lebensmittelkarte zu ergattern. Magnito-
gorsk wurde damit zum Fluchtpunkt und Überlebensort,
an dem der soziale Untergrund des Sowjetsystems das
Fundament der neuen Welt bilden sollte. Wer sich hierher
begab, wurde sofort in einen Strudel von Technik und Ter-
ror, von Aufbau und Raubbau hinein gesogen.
67
Das galt in gleicher Weise für das zwischen 1928 und
1932 an den Stromschnellen des Dnepr’ bei Zaporož’e
errichtete Flusskraftwerk. Dank massiver technologischer
Anschubhilfe aus den USA, Deutschland und Schweden
stellte dieser neue hydroenergetische Gigant das „Wahrzei-
chen der neuen sozialistischen Sowjetukraine“ dar. Wäh-
rend der revolutionäre Furor von Zwangskollektivierung
67 Schlögel (wie Anm. 17), S. 118-132; Stephen Kotkin: Magnetic Mountain.
Stalinism as a Civilization, Berkeley 1995; Thomas Flierl (Hg.): Standardstädte.
Ernst May in der Sowjetunion 1930–1933. Texte und Dokumente, Berlin 2012;
Philipp Blom: Die zerrissenen Jahre, 1918–1938, München 2014, S. 290–309;
Evgenija Konyševa/Mark Meerovič: Linkes Ufer, rechts Ufer. Ernst May und
die Planungsgeschichte von Magnitogorsk (1930-1933), Berlin 2014; Helmut
Altrichter: Ernst May: Musterstädte in der Sowjetunion, in: Horst Möller u.a.
(Hg.): Deutsch-russische Kulturbeziehungen im 20. Jahrhundert. Einflüsse
und Wechselwirkungen, München 2016‚ S. 95–106.
und Brachialindustrialisierung damals über die Landschaf-
ten und ihre Bewohner hinwegfegte, wurde das Kraftwerk
mit seinen Dämmen und Kanälen als „Bollwerk des Sozi-
alismus“ zelebriert, das nicht nur die reißenden Fluten des
Dnepr’ bändigte. Vielmehr sollte es sich auch den zerset-
zenden Kräften der Zweifler und Ungläubigen entgegen-
stellen. Der neue Kolossalbau stand als in Stahl und Beton
gegossener Brückenkopf der Industriemoderne dafür, dass
es „keine Festungen“ gäbe, die – so Stalin 1931 – „die Bol-
schewiki nicht einnehmen könnten“.
68
Mit den ersten beiden Fünfjahresplänen technisierte,
urbanisierte und proletarisierte sich die Sowjetunion. Die
Zahl der in der Industrie beschäftigten Arbeiterschaft ver-
dreifachte sich von 1928 bis 1940 auf 8,4 Millionen, die
des ingenieur-technischen Personals stieg von 119.000
auf 930.000. Ähnliche Zuwachsraten gab es bei Bau-
und Transportarbeitern.
69
Die zahlreichen Großbaustel-
len überall im Land wirkten als soziale Schmelztiegel, in
denen alte Überzeugungen und Werte ihre kulturelle Bin-
dekraft verloren, um neue Identitäten formen zu können.
Hier konnten sich Arbeiter und Ingenieure durch ihren
Arbeitseinsatz bewähren, sich als „Erbauer einer lichten
Zukunft“ profilieren und damit zu denjenigen sozialen
Trägerschichten werden, die sich die Kremlbosse sehn-
lichst als erforderliche Machtbasis gewünscht hatten.
70
Trotz des entfesselten wirtschaftlichen Wachstums blie-
ben die Kultstätten der stalinistischen Industrialisierung mit
ihren ins Grandiose und Utopische ausgreifenden Dimen-
sionen Orte sowohl des gesellschaftlichen Aufbruchs als
auch der sozialen Abgründe. Während die Arbeiter lernten,
hochmoderne Hochöfen in Betrieb zu nehmen, blieben ihre
Lebensbedingungen äußerst prekär. Es fehlte vor allem an
Wohnraum und an medizinischer Versorgung, aber auch
an Hygiene, Nahrungsmitteln und Massenbedarfsartikeln.
Hinter den verordneten Anstieg der Produktionsraten hatte
die Verbesserung der erbärmlichen Lebenssituation stets
zurückzutreten. Angesichts der weit verbreiteten Gewalt und
Not erwies sich die Sowjetmoderne in ihrer radikalisierten
Variante darum nicht nur als technologisch beeindruckend,
sondern zugleich als sozial und moralisch zurückgeblieben.
68 Anne D. Rassweiler: The Generation of Power. The History of Dneprostroi,
New York 1988.
69 Beyrau (wie Anm. 32), S. 134.
70 Matthew J. Payne: Stalin’s Railroad. Turksib and the Buildung of Socia-
lism, Pittsburgh 2001; Tanja Penter: Kohle für Stalin und Hitler. Arbeiten
und Leben im Donbass 1929 bis 1953, Essen 2010; Julia F. Landau: Wir
bauen den großen Kuzbass! Bergarbeiteralltag im Stalinismus 1921-1941,
Stuttgart 2012.
Der Russische Revolutionszyklus, 1905-1932, Teil 4: Geschehnisse 1918-1932


















