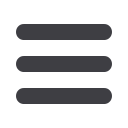

30
Einsichten und Perspektiven 1 | 18
gan „Mit dem Gesicht zum Dorf“ propagiert, doch bei
der beabsichtigten Herstellung eines „lebendigen Klas-
senbündnisses zwischen Bauern und Arbeitern“ (
smyčka
)
kam den Interessen des Dorfes tatsächlich nur nachran-
gige Bedeutung zu.
58
Zudem war innerhalb der Partei ein heftiger Konflikt
um den Sinn der NEP ausgebrochen. Dabei ging es nicht
zuletzt darum, wer sich im Diadochenkampf um die
Nachfolge des 1924 verstorbenen Lenins durchsetzte.
59
Leichtfertig verspielte die Partei mit ihren ideologisch
und machtpolitisch aufgeladenen Querelen wirtschafts-
politische Optimierungspotentiale. Als es dann 1927/28
infolge ungünstiger Wetterereignisse zu einer Missernte
kam, leerten sich die staatlichen Getreidespeicher in
bedrohlicher Weise. Die Parteieliten verloren auch die
letzte Hoffnung, dass sich mit der „Neuen Ökonomischen
Politik“ der herbeigesehnte schnelle Anschluss an die
industrielle Moderne erreichen ließ. Trotz der spürbaren
Regeneration der Volkswirtschaft hatte die Industriepro-
duktion 1926/27 außerdem erst den Stand von 1913 wie-
der erreicht.
60
Unter diesen Umständen übernahm Stalin
die radikalen Konzepte seines Widersachers Trotzkij, den
er kurz zuvor politisch kaltgestellt und ins Ausland ver-
trieben hatte. Lenins Rückzug auf die „Kommandohöhen
von Staat und Wirtschaft“ erklärte der Kreml endgültig
für beendet. Nun galt es, an allen „Fronten“ in Form eines
„großen Umschwungs“ in den Sozialismus „vorwärtszu-
springen“, um einen umfassenden Wandel der sozioöko-
nomischen Verhältnisse zu erzwingen.
Zwangskollektivierung und der erste Fünfjahresplan
1928-1932
Ausgestattet mit deutlich größerer Organisations- und
Durchschlagskraft machte sich der sowjetische Partei-
staat unter Stalin daran, die in den Wirren des Bürger-
kriegs gescheiterte Zerstörung der bäuerlichen Familien-
wirtschaft erneut anzugehen. Die nach 1928 verordnete
Zwangskollektivierung diente dazu, zum einen das Dorf
dem Willen der Partei zu unterwerfen und zum anderen
58 Wehner (wie Anm. 20), S. 266–362; Hessler (wie Anm. 19), S. 135-171;
James Hughes: Stalin, Siberia and the Crisis of the New Economic Policy,
Cambridge 1991; James Heinzen: Inventing a Soviet Countryside. State
Power and the Transformation of Rural Russia, 1917–1929, Pittsburgh
2004, S. 171–214.
59 Zum Tod Lenins und zu seinem politischen Testament vgl. Service (wie
Anm. 35), S. 599-618.
60 Andrei Markevich/Mark Harrison: Great War, Civil War and Recovery.
Russia’s National Income, 1913 to 1928, Moscow 2011, Tab. A13 und A14,
S. 30 f.
durch die rücksichtslose Ausbeutung der Landbewohner
die notwendigen Ressourcen und Arbeitskräfte für die
zugleich in Angriff genommene Brachialindustrialisierung
zu erhalten.
61
Die kleinen bäuerlichen Familienwirtschaf-
ten mussten ihr Land und Vieh sowie ihre Arbeitsgeräte an
die neu gegründeten Kollektivwirtschaften, die „Kolcho-
zen“, abtreten. Mit dieser Enteignung der Bauern kam es
zur Vernichtung der traditionellen Bauernwirtschaft und
damit zur Zerstörung des überlieferten Dorflebens. Die
proklamierte, aber nie tatsächlich umfassend realisierte
Industrialisierung des Agrarsektors machte aus zuvor
selbständigen Bauern lohnabhängige Landarbeiter. Diese
empfanden die ihnen aufgezwungene Neuordnung oft-
mals als „zweite Leibeigenschaft“, weil sie sich ihres Lan-
des und ihrer Freiheit beraubt und damit um die Früchte
der Revolution von 1917 gebracht sahen.
Bei der gnadenlosen soziopolitischen Flurbereinigung
des Landlebens richteten sich die Gewaltmaßnahmen der
aus Arbeitern und Soldaten bestehenden bewaffneten Kol-
lektivierungsbrigaden vor allem gegen die sogenannten
„Kulaken“, die es im Dorf zu etwas Wohlstand gebracht
hatten oder sprachmächtig und mutig genug waren, um
ihren Unmut zu äußern. Mit unbarmherziger Entmensch-
lichungsrhetorik verkündete der Kreml die „Liquidierung
der Kulaken als Klasse“. Diese bürgerkriegsähnliche Mas-
senkampagne kostete Anfang der 1930er Jahre 600.000
Dorfbewohnern ihr Leben. Zwei Mio. wurden aus ihren
Heimatdörfern in entlegene Peripherien deportiert, wo
sie sich gegen ihren Willen als Zwangsarbeiter ins sozia-
listische Aufbauwerk einbringen mussten. Weiter verloren
vier Mio. Bauern Heim und Hof; sie zogen in die Städte
und auf Großbaustellen, um sich dort meist in großer Not
eine neue Existenzgrundlage zu schaffen.
Die Liquidierungs- und Eliminierungsimperative führ-
ten ebenfalls zur Entweihung von Kirchen und anderen
Gotteshäusern. Während der 1930er Jahre wurde 90 Pro-
zent des Klerus der russisch-orthodoxen Kirche ermordet;
auch zahlreiche geistliche Würdenträger anderer Konfes-
sionen und Religionen fielen der atheistischen Gewalt-
politik zum Opfer. Stalin und seine Getreuen hatten
außerdem keine Skrupel den Hunger als politische Waffe
einzusetzen, um die Bauern und Nomaden Zentralasi-
ens in die neue sozialistische Ordnung auf dem Land zu
zwingen. Wegen dieser heftigen Verwerfungen endete die
61 Im ideologischen Duktus der Zeit sprach der damals führende sowjeti-
sche Ökonom Evgenij Preobraženskij (1886-1937) euphemistisch von der
„primitiven sozialistischen Akkumulation des Kapitals“. Zit. n. Smith (wie
Anm. 5), S. 234.
Der Russische Revolutionszyklus, 1905-1932, Teil 4: Geschehnisse 1918-1932


















