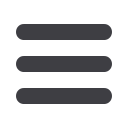

60
Einsichten und Perspektiven 4 | 17
von Union mit FDP und Union mit Grünen begannen
die Sondierungen in großer Runde, wobei sich zwischen-
drin eine kleinere Gruppe mit zentralen Akteuren getrof-
fen hat, um den Gesprächen neuen Schwung zu geben.
Da es keine gesetzlichen Fristen für die Regierungsbildung
gibt, deuteten sich langwierige Verhandlungen an – erst
das Erzeugen eines künstlichen, aber notwendigen Zeit-
drucks von Bundeskanzlerin Merkel, die Sondierungen
bis Mitte November zu beenden, sorgten schließlich für
Termindruck. Nach dem Scheitern der Sondierungen
kam erstmals dem Bundespräsidenten, der mit seinem
Kandidatenvorschlag den formalen Prozess der Regie-
rungsbildung eröffnet, eine bedeutende Rolle zu. Er ver-
deutlichtete seine Abneigung gegenüber Neuwahlen und
drängte alle Akteure, sich Gesprächen nicht zu verweigern
- zunächst mit Erfolg.
FDP und Grüne hätten ebenfalls als Premiere auf
Bundesebene nach den Sondierungen einen Parteitag
angesetzt, auf dem über die Ergebnisse der Gespräche
entschieden worden wäre. Die Grünen griffen damit
Erfahrungen auf, die sie bei neuen Bündnissen in den
Ländern gemacht haben. Gerade die grünen Parteimit-
glieder fordern Beteiligung ein und sind kritischer gegen-
über ihrer Parteiführung eingestellt.
64
So konnten in
Hamburg 2008 alle Parteimitglieder auf Parteiversamm-
lungen über ein schwarz-grünes Bündnis mitstimmen, im
Saarland wurden 2009 Regionalkonferenzen angesetzt
sowie ein Parteitag, der zwischen den Optionen Rot-Rot-
Grün und Jamaika auswählen sollte.
65
Auf solchen Parteitagen muss das Spitzenpersonal
erkennbare Gewinne vortragen, um eine Zustimmung
zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu erhal-
ten. Entsprechend ist ein Großteil der die Sondierungen
begleitenden Parteikommunikation als Signal an die
eigene Mitgliedschaft zu verstehen.
Schließlich planten FDP und Grüne ein mögliches
Ergebnis der Koalitionsverhandlungen allen ihren Par-
teimitgliedern in einem Mitgliederentscheid vorzule-
gen. Bündnis 90/Die Grünen, die bei ihrer Parteigrün-
dung noch die Basisdemokratie als ein Grundprinzip
festschrieben, haben vor der Bundestagswahl 2013 und
wieder 2017 Urwahlen zur Aufstellung ihrer Spitzenkan-
didaten durchgeführt – beide erzielten hohe Beteiligungs-
64 Vgl. Niko Switek: Bündnis 90/Die Grünen: Zur Entscheidungsmacht grü-
ner Bundesparteitage, in: Zeitschrift für Politikwissenschaft (Sonderband
2012), S. 121-154.
65 Vgl. Niko Switek: Bündnis 90/Die Grünen. Koalitionsentscheidungen in
den Ländern, Baden-Baden 2015.
raten. Es war allerdings die SPD, die nach der Wahl 2013
erstmals auf Bundesebene einen Mitgliederentscheid über
den Eintritt in eine Große Koalition ansetzte.
66
Da der
ausgehandelte Koalitionsvertrag durchaus sozialdemokra-
tische „Herzensthemen“ beinhaltete und sich die gesamte
Parteispitze für die Große Koalition stark machte, sprach
sich damals die große Mehrheit der Partei für die Regie-
rungsbeteiligung aus. Auf die gleiche Strategie setzt Mar-
tin Schulz auch nach der Wahl 2017. Seine vorsichtige
Öffnung für Gespräche verband er mit der Ansage, eine
mögliche Koalitionsvereinbarung in jedem Fall wieder
die ganzen Partei zur Abstimmung vorzulegen.
Das Scheitern der Jamaika-Verhandlungen
Die Rahmenbedingungen für eine erste Jamaika-Koa-
lition auf Bundesebene waren alles andere als schlecht.
Die Parteien hatten ein solches Bündnis vor der Wahl
nicht ausgeschlossen und die Sondierungen kamen nicht
als große Überraschung für die Wählerinnen und Wähler
daher. Die FDP fühlte sich durch die gelungene Rück-
kehr in den Bundestag gestärkt, die Grünen deuteten ihr
einige Prozentpunkte über den schwachen Umfragen lie-
gendes Ergebnis als Erfolg. Für alle Akteure galt es natur-
gemäß, ihre programmatischen Ziele sinnvoll in ein Pro-
gramm für eine Regierung zu überführen.
Es zeigte sich aber, dass einige andere Punkte die Son-
dierungen erschwerten und wohl letztlich zum Scheitern
beitrugen: Eine mit ihrem Wahlergebnis unzufriedene
und durch die Konkurrenz der AfD unter Druck gesetzte
Union konnte nur bedingt Zugeständnisse an Liberale
und Grüne machen, zumal auch die beiden kleinen Par-
teien in einigen Bereichen in sehr gegensätzliche Richtun-
gen zogen. Die Liberalen haben die letzte schwarz-gelbe
Bundesregierung in keiner guten Erinnerung – gut mög-
lich, dass ihnen eine Regierungsbeteiligung zu früh kam.
Bei den Grünen hingegen musste die Parteiführung den
Mitgliedern den Sprung über den Lagergraben schmack-
haft machen. Der linke Flügel der Partei, der vor allem
auf Fragen der sozialen Gerechtigkeit setzt, begleitete die
Gespräche mit wenig Sympathie und kritischen Kom-
mentaren.
Rechnerisch bleibt damit die Option einer Weiterfüh-
rung der Großen Koalition aus CDU, CSU und SPD
oder die erste Minderheitsregierung auf Bundesebene.
Einige Vertreter der SPD stellten in Aussicht, eine Min-
66 Vgl. Nicolai Dose: Innerparteiliche Demokratie: Der Mitgliederentscheid
bei der SPD, in Gesellschaft – Wirtschaft – Politik 4/2014, S. 519-527.
Wahlnachlese 2017


















