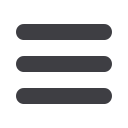

waren nicht in der Partei. Trotzdem
durften w ir unterrichten. Ich kenne
aber Kollegen, die wegen mißliebi–
ger Äußerungen aus dem Schuldienst
entfernt wurden.
Welche Rolle hat in diesem Zusam–
menhang das Fach "Staatsbürger–
kunde" gespielt, das zum Pflichtpro–
gramm in den Klassen sieben bis
zehn der Polytechnischen Oberschu–
le gehörte?
Die Lehrer für Staatsbürgerkunde–
waren selbstverständlich Mitglieder
der SED; sie nahmen regelmäßig an
ideologischen Fortbildungsveranstal–
tungen teil und waren - das wissen
wir offiziell erst seit kurzem - der je–
weiligen SED-Kreisleitung unterstellt.
So wurde vom Apparat gewährlei–
stet, daß in der Schule die Indoktrina–
tion sicher nicht zu kurz kam. Inhalt–
lich ging es in diesem Fach, etwa in
der Oberstufe, um die Aneignung
des Marxismus-Leninismus; es muß–
ten Zitate von Marx, Engels, Lenin,
Ulbricht oder Honecker analysiert
und mit der neuesten Entwicklung in
Einklang gebracht werden. Sie kön–
nen sich vielleicht vorstellen, welch
eine trockene Angelegenheit das
war. Viele haben den Staatsbürger–
kundelehrer angesichts der immer
größer werdenden Widersprüche
zwischen Ideologie und Realität gar
nicht mehr ernst genommen.
Wir sind wirklich froh darüber, daß
der Staatsbürgerkundeunterricht An–
fang 1990 abgeschafft und durch das
vollkommen neue Fach Gesell–
schaftskunde ersetzt wurde. ln die-
14 SCHULE
aktuell
"Die SED
hatte
natürlich
auch
in der
Schule
das Sagen."
sem Fach gibt es vorerst keine Noten.
Die Schüler müssen sich erst an die
neuen Spielregeln gewöhnen, denn
bisher wußten sie nur zu gut, welche
Äußerungen gern gehört wurden und
welche man besser nicht öffentlich
vorbrachte.
Welche Sicht hatten die Lehrer zu
vermitteln, wenn es um die Bundes–
republik Deutschland ging?
Noch in den sechziger Jahren sprach
man vom " Klassenfeind", von dem
es sich abzugrenzen und vor dem es
sich zu schützen galt. Das Bild von
der Bundesrepublik wurde in aggres–
siven Farben gemalt. Wer da eine
abweichende Meinung vertreten
wollte, mußte darauf gefaßt sein,
selbst als Klassenfeind gebrand–
markt zu werden. ln den siebziger
Jahren änderte sich die Tonlage.
Jetzt konnte man einfach nicht mehr
verheimlichen- das Fernsehen liefer–
te ja genug Anschauungsmaterial -,
daß "drüben" ein außerordentlich
leistungsfähiges Wirtschaftssystem
entstanden war; dafür wurden nun
bei Ihnen sicherlich vorhandene Pro–
bleme wie Arbeitslosigkeit, Obdach–
losigkeit oder Drogenmißbrauch in
unseren Medien aufgebauscht, um
sich vom Westen abzugrenzen. Bis zu
einem gewissen Grad habe auch
ich diese Schwarzweißmalerei für
wahr gehalten - es fehlte uns eben
die eigene Anschauung. So konnten
sich bei uns Erwachsenen Vorurteile
bilden, und die Schüler bekamen sie
natürlich weitervermittelt
Ich möchte ffier einen Beleg aus dem
Unterricht anfügen: Wenn ich jetzt
in Gesellschaftskunde die soziale
Marktwirtschaft behand le - wir ha–
ben dafür vor kurzem Bücher von
einer Schule in Unterfranken bekom–
men -, so wollen manche Schüler
noch gar nicht akzeptieren, daß das
gewohnte Bild von der bundesdeut–
schen "Wolfsgesellschaft", wo der
Stärkere dem Schwächeren keine
Chance läßt, korrig iert werden muß.
Können Sie uns einige Grundsätze
der schulischen Erziehung in · der
DDR nennen?
Das Erziehungsziel war die " soziali–
stische Persönlichkeit". Freilich ist
dieses Ziel nie erreicht worden -Indi–
viduen lassen sich eben nicht voll–
kommen gleich ausrichten. Und es
,gab immer wieder Schüler, die sich
gegen die Vereinnahmung sogar ge–
wehrt haben. Der Unterricht selbst
war allerdings schon sehr straff or–
ganisiert. So hatte ein Schüler, der
Gruppenvorstand oder Ordnungs–
schüler, "Achtung" zu rufen, wenn
der Lehrer das Klassenzimmer betrat,
und z. B. folgende Meldung zu ma–
chen: "Herr Schmidt, die Klasse 8a ist
mit 21 Mann zum Unterricht bereit.
Schüler Kaufmann fehlt. "
Welche Möglichkeiten hatten ei–
gentlich die Schulabgänger, ihren
Berufswunsch zu realisieren?
Für die Absolventen der POS gab es
in jedem Kreis ein Lehrstellenver–
zeichnis. Wer seinen Beruf in diesem
Verzeichnis nicht fand, mußte sich
umorientieren oder auswärts auf die
Suche gehen; jedem Absolventen der
Polytechnischen Oberschule war
"Wir müssen uns erst an die


















